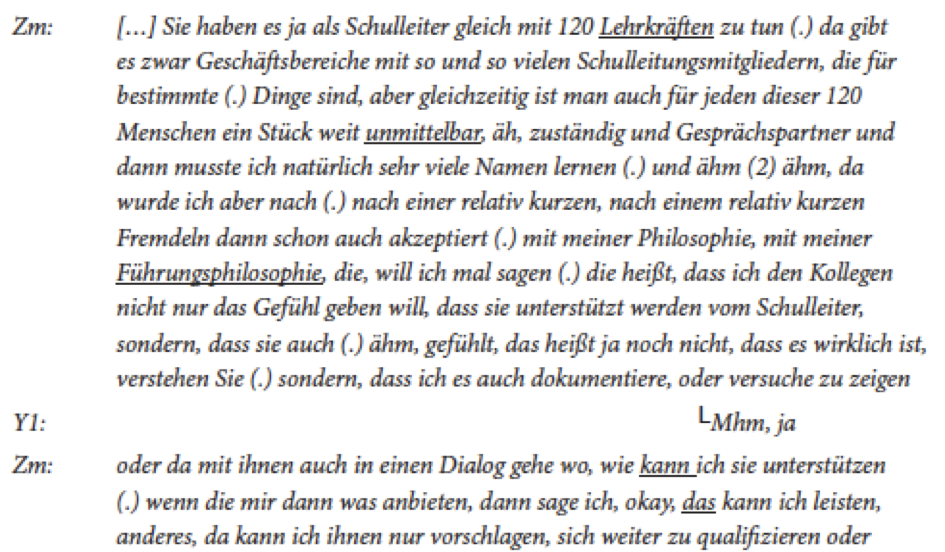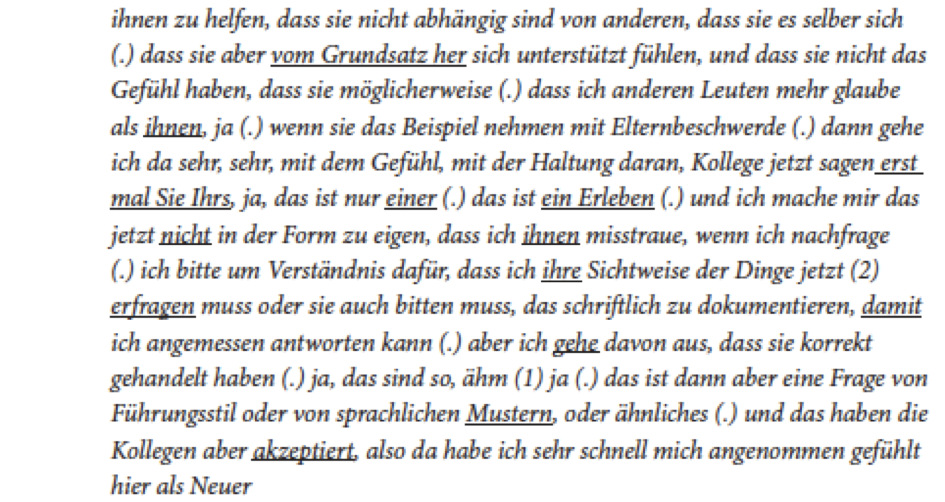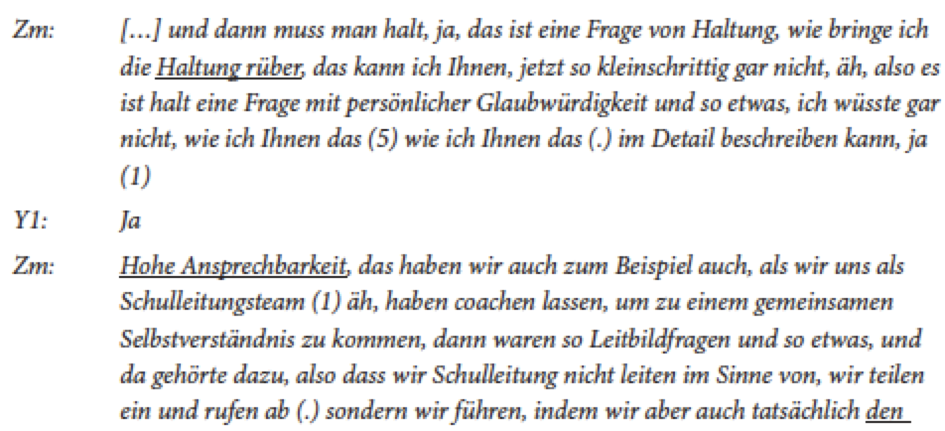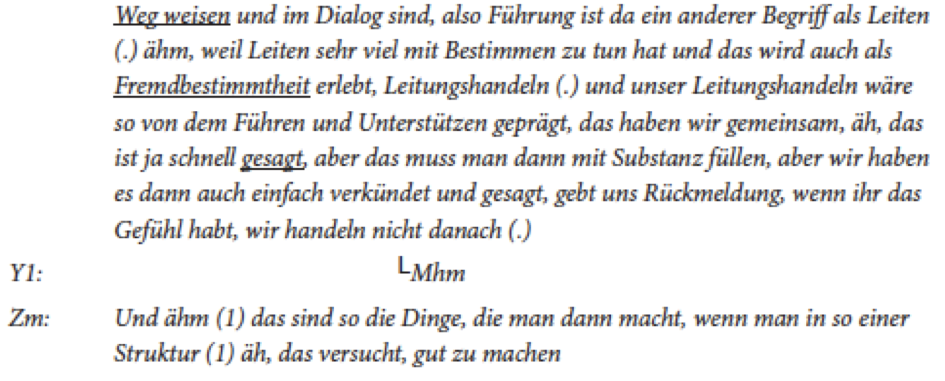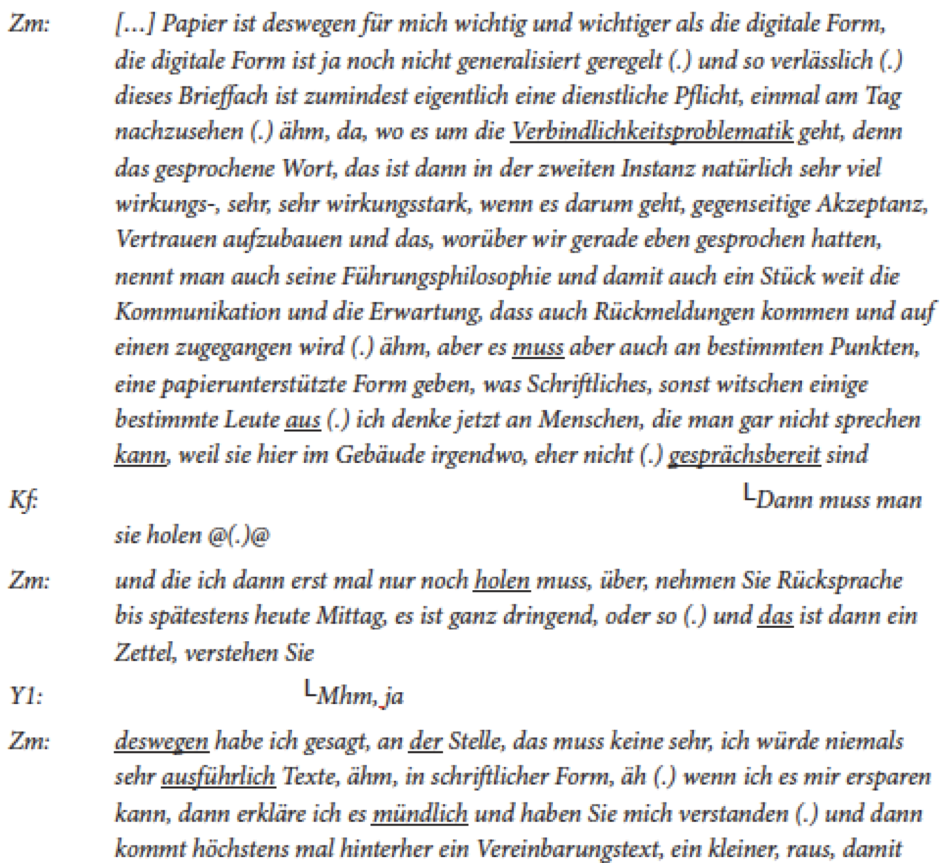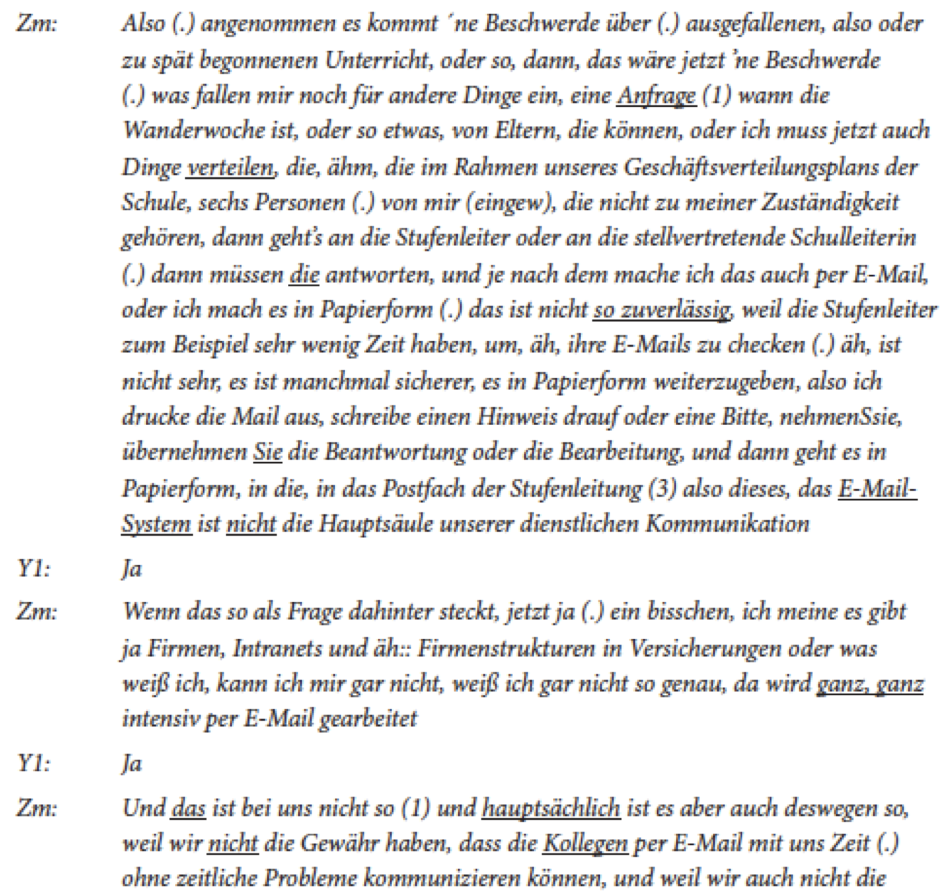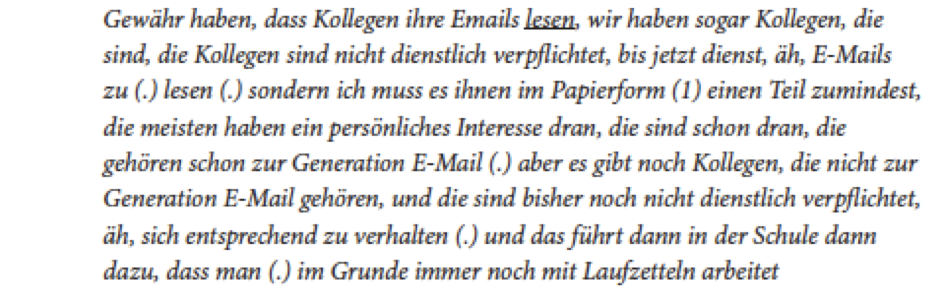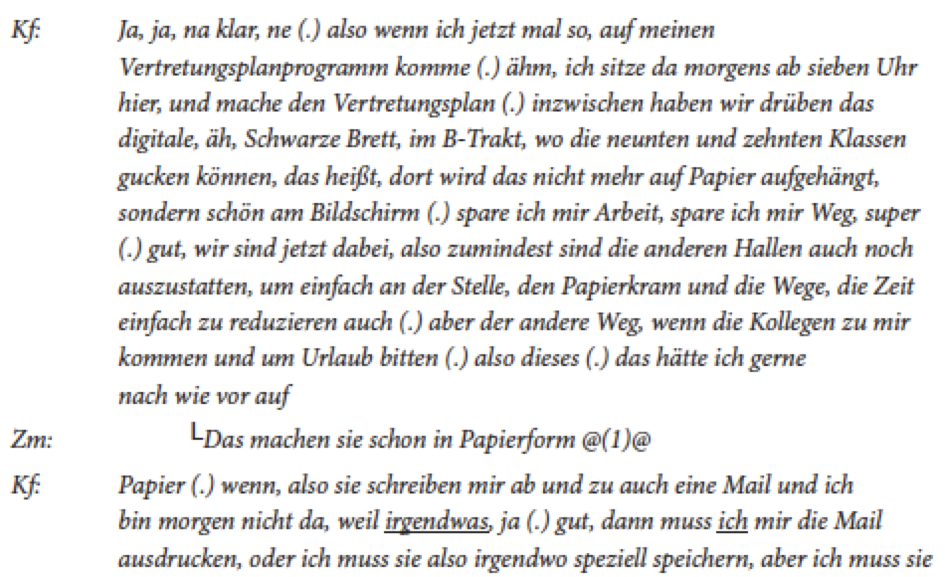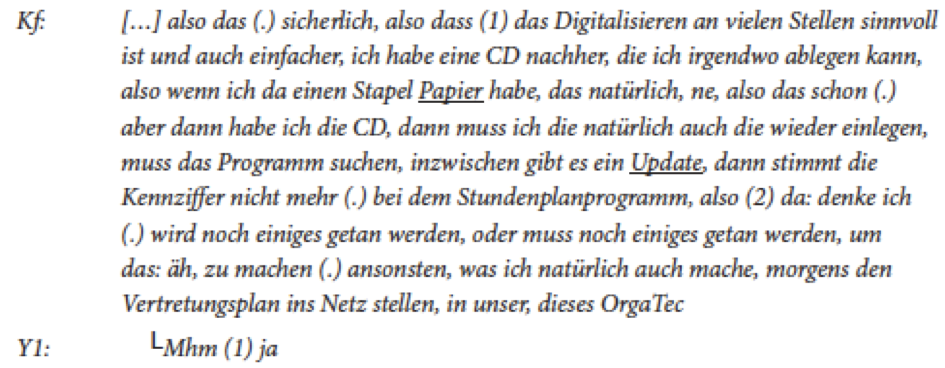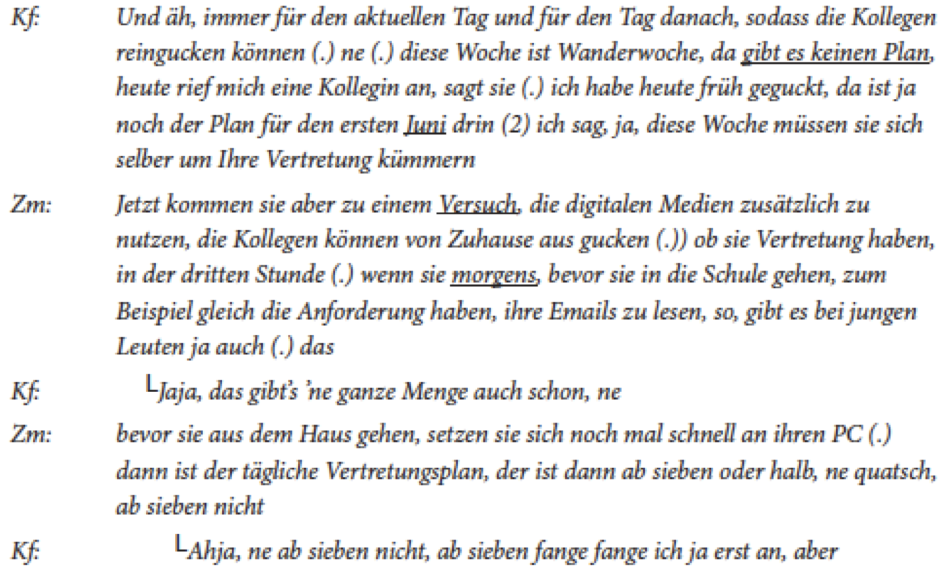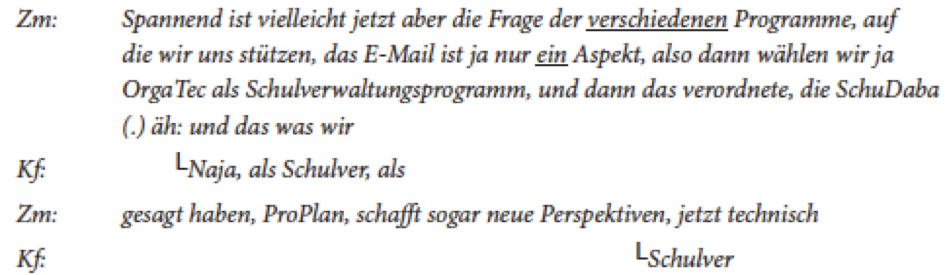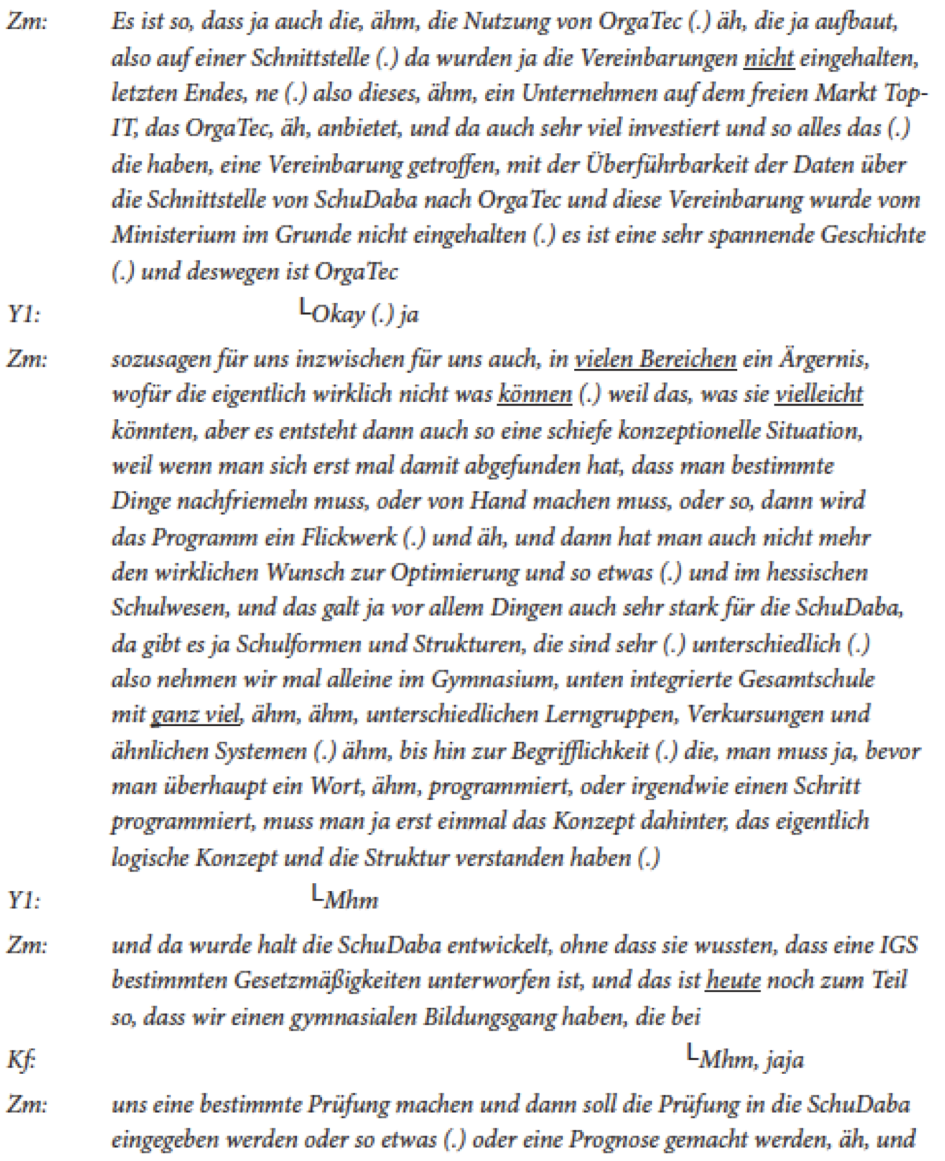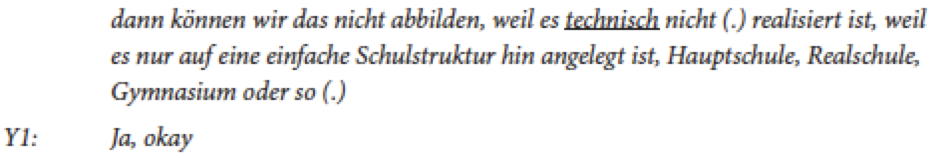Hinweis: Der Fall kann gemeinsam gelesen werden mit:
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Ahorn“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Zypresse“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Lärche“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Esche“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Platane“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Bergschule in B-Stadt: Die Gruppe Fichte“
- „Mediatisierte Organisationswelten in Schulen – Die Waldschule in A-Stadt: Die Gruppe Buche“
Einleitende Bemerkungen
Die Waldschule ist eine integrierte Gesamtschule mit etwa 1.300 Schülerinnen und Schülern, die in den Jahrgängen 5 bis 10 achtzügig unterrichtet werden. Auf dem Schulgelände befindet sich auch noch die Oberstufe der Waldschule, die aber nicht Teil der Untersuchung war. Die verschiedenen Gebäude verteilen sich über ein relativ großes Gelände. Im Zentrum steht ein zweistöckiger, riegelartig aufgebauter Komplex. Aufgrund der Weitläufigkeit der Schule müssen die Pädagoginnen und Pädagogen häufig relativ lange Wege zurücklegen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Jeder Jahrgang befindet sich in einem eigenen Gebäudeteil. Dazu kommen weitere separate Gebäude wie die Aula, die Sporthallen und ein kleiner restaurantartiger Betrieb der von Schülerinnen und Schülern geführt wird. An der Schule sind etwa 120 Lehrkräfte inklusive Referendarinnen und Referendaren sowie Sonderschulpädagoginnen und -pädagogen tätig. Dazu kommen eine kleine Gruppe von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern, Verwaltungsangestellte, die im Sekretariat der Schule arbeiten und Hausmeister. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer eines Jahrgangs treffen sich normalerweise alle zwei Wochen zur Jahrgangskonferenz. Während der Feldphase gab es mindestens einen Jahrgang, dessen Mitglieder sich nur monatlich trafen. Jeder Jahrgang sollte eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen, die/der u. a. einen Teil der Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Schulleitung und den Mitgliedern eines Jahrgangs übernimmt. In jeder Klasse unterrichten eine Klassenlehrerin bzw. ein -lehrer sowie eine Co-Klassenlehrerin bzw. ein -lehrer. Jeweils zwei Klassen eines Jahrgangs sind enger miteinander verzahnt und die Schülerinnen und Schüler werden teilweise auch gemeinsam unterrichtet.
Falldarstellung mit interpretierenden Abschnitten
Die Gruppe Birke besteht aus Herrn Zieber, dem Schulleiter der Waldschule, und Frau Krause, seiner Stellvertreterin. Herr Zieber ist dort seit sechs Jahren Schulleiter. Frau Krause arbeitet dort auch schon seit mehreren Jahren. Streng genommen handelt es sich bei der Gruppendiskussion über weite Strecken um ein Interview, denn sie beginnt ohne Frau Krause und zwischenzeitlich verlässt sie die Diskussion für längere Zeit. Diese Begebenheit illustriert auch die hohe arbeitspraktische Belastung von Schulleitungsmitgliedern. In die Fallbeschreibung ist außerdem ein zu einem früheren Zeitpunkt geführtes kürzeres Interview mit Herrn Zieber eingeflossen.
Das Primat interpersonaler direkter Kommunikation
Am Thema des Forschungsvorhabens orientiert, möchte der Interviewer von Herrn Zieber wissen, wie er die Kommunikation mit dem Kollegium erlebt habe, als er seine Arbeit an der Waldschule begann. Der Schulleiter reagiert darauf mit dem Hinweis, dass die Hierarchie an der Waldschule „flach“ sei, d. h., ihm als Schulleiter sind keine personellen Instanzen vorgeschaltet, die die Kommunikation mit ihm erschweren. Damit müsse er aber auch prinzipiell bereit sein, mit jeder der rund 120 an der Schule tätigen Lehrkräfte zu kommunizieren (Gruppe Birke, Passage „Kommunikative Philosophie“).
Die Schule verfügt zwar über mehrere Geschäftsbereiche, denen Schulleitungsmitglieder vorstehen, die Verantwortung für verschiedene Aufgaben tragen und damit den Schulleiter von bestimmten Aufgaben entlasten. Das entbindet ihn aber nicht von seiner unmittelbaren Verantwortung für jede einzelne Lehrkraft, die sich auch darin äußert, dass er für jedes Kollegiumsmitglied prinzipiell ansprechbar sein muss. Um diese Rolle auszufüllen, musste er zu Beginn seiner Arbeit an der Schule eine Phase des Kennenlernens und Vertrautmachens durchlaufen, während der er u. a. die Namen der Kollegiumsmitglieder lernen musste, um sie adäquat ansprechen zu können. Offensichtlich wurde er als neuer Schulleiter von den Lehrkräften nicht sofort akzeptiert, denn er spricht von einer „relativ kurzen“ Phase des „Fremdelns“, d. h., das Vertrauen in seine Person wurde dem Schulleiter nicht per Rollenzuschreibung automatisch zuteil. Anscheinend ging es ihm aber nicht nur darum, von den Lehrkräften als Person anerkannt und respektiert zu werden, sondern dass diese auch seine „Führungsphilosophie“, d. h. die Motive seines Handelns als Schulleiter, akzeptieren.
Herr Zieber möchte in diesem Kontext erreichen, dass die Lehrkräfte wissen, dass er sie unterstützt. Er kann ihnen dafür zunächst einmal ein „Gefühl“ geben, d. h. die Empfindung, dass sie unterstützt werden. Das sei aber noch nicht „wirklich“, d. h., es erreicht nicht den Status des Tatsächlichen bzw. des Realen. Erfahr- und nachvollziehbar wird die Unterstützung des Schulleiters erst durch ihren sichtbaren Vollzug, d. h., wenn sie leibhaftig wird. Dafür zeigt er sich den Lehrkräften (wenn er z. B. in der großen Pause in das Lehrerzimmer kommt, vgl. Kapitel 3.1.1) und sucht die Kommunikation mit ihnen bzw. bietet sie an. Im Zuge der Face-to-Face-Kommunikation kann er u. a. herausfinden, wie er die Lehrkräfte unterstützen kann. Dabei kann er außerdem spontan reagieren und z. B. bestimmte Leistungen anbieten oder Vorschläge machen, wie die Lehrkräfte handeln können.
Unabhängig davon, welche Handlungspraxis der Schulleiter in der Kommunikation mit den Lehrkräften entwickelt, ist es ihm wichtig, dass diese generell davon ausgehen, dass er sie unterstützt und ihnen ein grundlegendes, nicht in Frage zu stellendes Vertrauen entgegenbringt. Er exemplifiziert diese Einstellung anhand der Elternbeschwerde. In diesem Fall sind bestimmte formale Regeln des Umgangs einzuhalten, die Herr Zieber der betroffenen Lehrperson kommuniziert. Er müsse sie z. B. auffordern, den Gegenstand der Beschwerde schriftlich darzustellen, um in angemessener Form darauf antworten zu können, d. h. mit den Eltern darüber kommunizieren zu können. Generell gehe er in solchen Situationen aber zunächst davon aus, dass die Lehrkraft richtig („korrekt“) gehandelt hat. Die Kommunikation über den Sachverhalt und seine Bearbeitung erfolgt auf zwei Regelungsebenen: einer formalen durch externe Orientierungsschemata vorgegebenen und einer informellen Konkretisierung, die vom Vertrauensverhältnis zwischen dem Schulleiter und den Lehrerinnen und Lehrern geprägt ist und einen gemeinsamen Orientierungsrahmen schafft, der die Grundlage zur handlungspraktischen Bewältigung solcher Konflikte liefert.
Im Rahmen einer Schulleiterfortbildung habe Herr Zieber auch gelernt, sein Kollegium „durch Dialog“ zu führen, sodass die interpersonale direkte Kommunikation ein wichtiges Instrument ist, die Mitglieder eines Kollegiums in geeigneter Weise anzuleiten. Der Schulleiter fährt fort, dass das Ausfüllen seiner Rolle letztlich auch eine Frage der „Haltung“ sei, und wie man diese kommuniziere. Die Haltung verweist auf die innere Grundeinstellung, die das Denken und Handeln prägt, oder mit anderen Worten: die (berufs-)biografischen Orientierungen, die die Handlungspraxis begründen (Gruppe Birke, Passage „Kommunikative Philosophie“).
Da es sich um biografische Orientierungen handelt, kann der Schulleiter diese nicht direkt artikulieren. Ersatzweise verweist er auf den Aspekt der Glaubwürdigkeit in dem Sinne, dass seine Handlungspraxis den Kollegiumsmitgliedern als wahr und richtig bzw. zuverlässig erscheint, sodass sie ihm folgen können. Insofern ist es wichtig, dass der Schulleiter dem Kollegium seine (berufs-)biografischen Orientierungen kommuniziert. Er wird dabei aber mit der Schwierigkeit konfrontiert, diese nicht ohne weiteres explizieren zu können. Die Problematik wird gelöst, indem er diese Orientierungen mit fremder Hilfe auf ein höheres Aggregationsniveau befördert. Dabei geht der Schulleiter in der Gruppe der Schulleitungsmitglieder auf und sie entwickeln mit fremder Hilfe ein gemeinsames Orientierungsschemata (Leitbild), an dem die Mitglieder des Kollegiums ihre Handlungspraxis orientieren sollen, und das sich im günstigsten Falle in den (berufs-)biografischen Orientierungen der Lehrkräfte niederschlägt.
Die Schulleitung versteht sich laut Herrn Zieber nicht als Leitung im etablierten Sinne, indem man einteile und abrufe, d. h., dass man den Lehrkräften genaue Aufgaben zuweist und die damit verbundenen Handlungspraxen bedarfsweise einfordert. Stattdessen versucht sie, die Lehrkräfte zu „führen“, was sich u. a. darin niederschlägt, dass die Schulleitungsmitglieder den „Weg weisen und im Dialog sind“. Sie zeigen handlungspraktisch auf, wie die Lehrkräfte ihren Arbeitsauftrag erfüllen sollen, und kommunizieren mit selbigen kontinuierlich über die Umsetzung. Im Gegensatz dazu habe Leiten „sehr viel mit Bestimmen zu tun“, d. h., dass den Lehrkräften vorgeschrieben wird, was sie zu tun haben, sodass diese sich letztlich auch als fremdbestimmt erleben würden. Stattdessen wolle man als Schulleitung die Lehrkräfte bei ihrem professionellen Tun unterstützen. Während sich solche Ansprüche an die Führungsfunktion einer Schulleitung relativ schnell formulieren lassen, ist es sehr viel voraussetzungsreicher, eine korrespondierende Handlungspraxis zu entwickeln („mit Substanz füllen“). Daher habe man „es“ letztlich dem Kollegium mitgeteilt mit der Bitte, der Schulleitung zu signalisieren, wenn die Lehrkräfte den Eindruck haben, dass die Schulleitungsmitglieder nicht nach den von ihnen formulierten Prämissen handeln. Das Pronomen „es“ repräsentiert den angesprochene Führungsstil, der in ein Orientierungsschemata überführt, von den Lehrkräften gegen die Handlungspraxis der Schulleitungsmitglieder gespiegelt werden kann. Herr Zieber beendet seine Erzählung mit der Zwischenkonklusion, dass man Handlungspraxen, wie die von ihm beschriebenen, enaktiere, wenn man darum bemüht sei, eine gute Struktur zu errichten. Insofern ist sich der Schulleiter darüber bewusst, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Qualität der schulinternen Kommunikation und der Qualität der Schulorganisation bzw. Struktur besteht. Neben der Qualität ist die erzielbare Verbindlichkeit ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Entscheidung des Schulleiters für bestimmte kommunikative Praktiken (Gruppe Birke, Passage „Papier ist in manchen Situationen unverzichtbar“).
Das Medium Papier ist für den Schulleiter wichtiger als die „digitale Form“, da diese noch nicht „generalisiert geregelt“ und nicht „so verlässlich“ sei. Der Begriff der Form zeigt zum einen auf die Gestalt der eingesetzten Kommunikate, zum anderen auf die Art und Weise der Kommunikation, d. h. die Frage, wie kommuniziert wird. Bezüglich der digitalen Medien mangelt es noch an allgemein gültigen Vorgaben, die einen vorhersehbaren Kommunikationsverlauf garantieren. Im Gegensatz dazu sind die Lehrkräfte z. B. dienstlich verpflichtet, mindestens einmal täglich ihr Postfach zu kontrollieren. Insofern kann Herr Zieber z. B. sicher sein, jede Lehrkraft innerhalb von spätestens 24 Stunden zu erreichen, wenn sie in der Schule ist.
Zum Grad der erzielbaren Verbindlichkeit der schulischen Kommunikation tritt als weiterer Aspekt deren Wirksamkeit. Im Vergleich zur schriftlichen papierbasierten Kommunikation sei die direkte interpersonale Kommunikation selbstverständlich um ein vielfaches wirksamer, wenn man mit der Kommunikation darauf abzielt, „gegenseitige Akzeptanz [und] Vertrauen“ im Kollegium aufzubauen. Auch diesen Aspekt subsumiert der Schulleiter unter dem Label der „Führungsphilosophie“. Die Form der Kommunikation im Kollegium wird somit zu einem schulkulturellen Qualitätsmerkmal, das u. a. auszeichnet, dass die Lehrkräfte „Rückmeldungen“ bekommen und die Schulleitung die Kommunikation mit ihnen sucht. Im Gegensatz zur Nutzung digitaler Medien ist die interpersonale direkte Kommunikation i. d. S. auch leiblich erfahrbar. Das verweist auf die hohe Bedeutung der materiellen Anteile der Kommunikation für die Qualität der Kommunikation an sich.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Kommunikation mittels papierbasierter Kommunikate unverzichtbar. Das gilt z. B. für Lehrkräfte, mit denen der Schulleiter nicht sprechen kann, da er ihnen nicht begegnet bzw. sie nicht an der Face-to-Face-Kommunikation mit ihm interessiert sind oder sich dieser gar zu entziehen versuchen. Frau Krause zufolge müsse man diese Personen „holen“, d. h., die Schulleitung muss die direkte interpersonale Kommunikation bedarfsweise erzwingen. Herr Zieber verifiziert Frau Krauses Einschränkung, dass er diese Personen z. B. schriftlich auffordert, mit ihm Rücksprache zu halten. Er versucht aber, den Umfang solcher Kommunikate auf das erforderliche Minimum zu reduzieren, dienen sie doch nur der Herbeiführung der von ihm als zentral erachteten Face-to-Face-Kommunikation. Im äußersten Fall wird im Nachgang einer solchen Begegnung ein kurzer Text angefertigt, der die Ergebnisse dieser Kommunikation dokumentiert und mittels der daraus resultierenden Nachvollziehbarkeit das benötigte Maß an Verbindlichkeit zuteilwerden lässt, das in solchen Fällen offenbar nicht allein auf der Basis der interpersonalen direkten Kommunikation hergestellt werden kann.
Kommunikation und Kulturwandel
Natürlich nutzt der Schulleiter auch die digitalen Medien. Anders wäre seine Arbeit auch nicht mehr zu bewältigen. Im Gespräch beschreibt er sich z. B. selber als erfahrenen und kompetenten Benutzer bestimmter Tabellenkalkulationsprogramme. Mit außerhalb der Schule angesiedelten Akteuren kommuniziert er selbstverständlich auch per E-Mail. In der Schule erfolgt dabei aber u. U. ein sofortiger Medienwechsel, indem der Schulleiter z. B. ein Kommunikat, das er per E-Mail erhalten hat, ausdruckt, um es über das traditionelle Postfach an jemanden weiterzugeben (Gruppe Birke, Passage „Generation E-Mail“).
Teilweise sind es Eltern, die sich per E-Mail mit ihren Anliegen an den Schulleiter wenden, die er dann nach Maßgabe der im „Geschäftsverteilungsplan“ festgelegten Zuständigkeiten verteilt. In einem Regelwerk ist formal festgelegt, welche interne Einheit der Organisation für die Bearbeitung eines bestimmten Sachverhalts zuständig ist. In der Schule ist das eine Person, die eine der Stufenleitungen innehat, oder die stellvertretende Schulleiterin. Teilweise leitet Herr Zieber solche E-Mails einfach an die zuständigen Personen weiter, die dann gezwungen seien, darauf zu reagieren. Für die Kommunikation mit den Stufenleiterinnen bzw. den -leitern sei aber E-Mail „nicht so zuverlässig“, da sie nur sehr wenig Zeit hätten, um den Eingang ihrer E-Mails zu überprüfen. Daher sei es „manchmal sicherer“, Kommunikate in „Papierform“ weiterzugeben, d. h., diese Kommunikation ist zuverlässiger und der Schulleiter muss weniger Zweifel haben, dass sie misslingen könnte. Dann druckt er die E-Mails aus und ein zusätzlicher handschriftlicher Hinweis teilt der Adressatin oder dem Adressaten mit, wie sie oder er mit dem Kommunikat weiter zu verfahren hat. Im nächsten Schritt kann diese Mitteilung dann in das Postfach z. B. der Stufenleitung transportiert werden. Der Schulleiter konkludiert seine Beschreibung mit dem Hinweis, dass „das E-Mail System […] nicht die Hauptsäule unserer dienstlichen Kommunikation“ sei. Das heißt, E-Mail spielt für die Belange der offiziellen und formalisierten schulorganisatorischen Kommunikation nur eine eingeschränkte Rolle. Im Gegensatz dazu gebe es Unternehmen, in denen „ganz intensiv per E-Mail gearbeitet“ werde, d. h., E-Mail ein zentrales Medium der betrieblichen Kommunikation ist. Der aufgezeigte Gegenhorizont ist aber mehr oder weniger neutral und zeigt lediglich an, dass es andere große Organisationen gibt, in denen die organisatorische Kommunikation ohne digitale Medien gar nicht mehr denkbar ist.
Dass E-Mail zumindest für die dienstliche Kommunikation in der Schule keine besondere Rolle spielt, sei aus der Sicht des Schulleiters vor allem darauf zurückzuführen, dass damit nicht zu gewährleisten ist, Kommunikation ohne zeitliche Verzögerungen durchzuführen. In einigen Fällen ist sogar zu bezweifeln, dass die Kommunikation so überhaupt gelingen kann, da nicht sicherzustellen ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen an sie adressierte E-Mails auch lesen. Da die Lehrkräfte dienstlich nicht verpflichtet sind, E-Mails zu lesen, ist der Schulleiter gezwungen („ich muss“), mit einem Teil von ihnen mittels schriftlicher Mitteilungen über ihr Postfach zu kommunizieren, wenn er sie verbindlich erreichen will. Es handelt sich aber um eine Minderheit und es ist nicht auszuschließen, dass sich diese Situation verändert, sodass alle Lehrkräfte irgendwann E-Mail für die schulorganisatorische Kommunikation nutzen müssen. Die meisten hätten aber ein „persönliches Inter- esse“ daran, auch dienstliche E-Mails zu lesen. Denn sie gehörten der „Generation E-Mail“ an, der Schulleiter schreibt dem Medium also sogar generationsbildende Eigenschaften zu, was dessen Relevanz zusätzlich unterstreicht. Bis es soweit ist, müsse man aufgrund der beschriebenen Situation in der Schule „immer noch“ mit
„Laufzetteln“ arbeiten, sodass sich der Schulleiter bis auf weiteres papierbasierter Hilfsmittel zur Prozessverfolgung bedienen muss. Die temporale Anbindung der Äußerung deutet darauf hin, dass es ihm lieber wäre, er könnte mit dem gesamten Kollegium bedarfsweise auch per E-Mail kommunizieren.
Herr Zieber zieht aber auch deutliche Grenzen der Kommunikation per E-Mail. Er rät z. B. davon ab, so mit Eltern zu kommunizieren, denn dadurch würden u. a. „die Erwartungen an eine Intensivierung der Kommunikation“ steigen. Er geht also davon aus, dass dieser Medienwechsel den Arbeitsumfang der Kommunikation mit den Eltern ausweiten würde. Konsequenterweise schlussfolgert er in dieser Situation, dass es „leichter [ist] zu telefonieren“, sodass diese Handlungspraxis auch weniger aufwendig ist. Er kritisiert die Eltern aber nicht dafür, dass sie es vorziehen, von den Lehrkräften Informationen per E-Mail zu erhalten. Die Perspektivenübernahme fällt ihm nicht schwer, da es ihm genauso geht und er i. d. S. strukturidentische Erfahrungen mit den Eltern teilt (Interview Zieber).
Herr Ziebers Einschätzung basiert auf seinen eigenen Erfahrungen im Umgang mit den digitalen Medien bzw. den daraus rührenden Orientierungen. So könne er z. B. auf seinem Computer gespeicherte Daten „zur Not ein zweites Mal ausdrucken“. Es ist aber nicht so sehr von Vorteil, dass er die Kommunikate in digitaler Form besitzt, sondern dass er sie jederzeit wieder in papierbasierte Kommunikate umwandeln kann, indem er sie ausdruckt. Dass z. B. Dokumente verlorengehen, ist auf sein „Alltagschaos“ zurückzuführen, das die Folge „einer enormen Verdichtung des Arbeitsrhythmus“ sei.[1] Der Arbeitsalltag des Schulleiters ist in Folge der Intensivierung der regelmäßigen Wiederkehr bestimmter Elemente (seiner Aufgaben) in seiner Abfolge ungeordnet. Diese Situation trage auch dazu bei, „dass Dinge verschwinden, wenn sie nur in Papierform existieren“, sodass sich das papierbasierte Kommunikat als nicht mehr adäquat bzw. als nicht zuverlässig genug erweist für die Arbeit innerhalb einer sich verändernden Organisationskultur.
Im Zuge dieses Wandels veränderten sich auch „Kulturtechniken“ und „Konventionen“. Kulturtechniken bezeichnen allgemein Methoden, um anderen die Inhalte einer Kultur mitzuteilen und für nachfolgende Generationen überliefern zu können. Als klassische Kulturtechniken gelten Lesen, Schreiben und Rechnen. Der Hinweis auf die Veränderung solcher Techniken knüpft an die Formulierung an, dass auch bestimmte digitale Medienpraxen inzwischen den Rang von Kulturtechniken besäßen. Von Veränderungen sind aber auch Konventionen betroffen. Das sind Bräuche genauso wie Sitten und Verhaltensnormen, sodass die veränderten Orientierungsschemata des Schulleiters zum Wandel elementarer Praxen der materiellen kulturellen Reproduktion (Kulturtechniken) beitragen.
Dann greift Herr Zieber den zu Anfang angesprochenen Aspekt der Verbindlichkeit abermals auf. Verbindliche Kommunikation ist nicht ausschließlich an den Aspekt der Schriftlichkeit gebunden. So könne er z. B. auch in direkter Interaktion etwas „versprechen“. Dabei komme beim Gegenüber eine andere „Botschaft“ an, als wenn er ihm oder ihr sage, dass er „schauen“ werde, ob er das „umsetzen“ könne. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer „sprachlichen Figur“, mit der man „unterschiedliche Erwartungen wecken“ könne. Verbindlichkeit wird somit auch davon bestimmt, was man inhaltlich miteinander kommuniziert, unabhängig vom eingesetzten Medium. Der Inhalt der Kommunikation bestimmt danach, welche Erwartungen bei den an der Kommunikation beteiligten Akteuren zurückbleiben. Vor diesem Hintergrund verweist der Einsatz digitaler Medien zum Zwecke der Kommunikation aus der Sicht von Herrn Zieber zunächst nur auf „eine neue technische Form“, die u. a. dazu beiträgt, „Kommunikation zu vervielfachen [und] auszudifferenzieren“. Kommunikation nimmt eine veränderte, technisch vermittelte Gestalt an, die u. a. zur Folge hat, dass selbige vervielfacht (wenn man z. B. mit Hilfe einer Mailingliste dem Kollegium etwas mitteilt) oder differenziert wird. Letzteres geschieht z. B., wenn man die Verteilungsmechanismen von E-Mails (z. B. CC oder BCC) nutzt, um verschiedene Personen gezielt auf unterschiedlichen Niveaus an einer kommunikativen Situation zu beteiligen. Kommunikation lasse sich dadurch ‚bereichern‘, d. h. sie gewinnt im positiven Sinne an Qualität. Eventuell werde sie auf diesem Wege auch „effizienter“, d. h., ihr Wirkungsgrad erhöht sich ebenfalls. Gleichzeitig verliere sie im Zuge ihrer Technisierung „andere Dinge“, die skizzierte Entwicklung ist insofern ambivalent. Schreibe man z. B. eine „Sammelmail“ an das Kollegium, verbleibt man in der Annahme, alle erreicht zu haben, d. h., jede Lehrkraft hat das gesendete Kommunikat erhalten. Funktional ist diese Annahme richtig. Fraglich bleibe aber, ob man auch alle „im Kopf […] oder im Herz“ erreicht habe. Die physisch-technische Übermittlung der Kommunikate garantiert keine gelingende Kommunikation. Unklar bleibt zum einen, ob es zu einer kognitiven Übereinkunft kommt, d. h., ob die Nachricht auch in der von der Senderin oder dem Sender intendierten Weise von den Rezipientinnen oder Rezipienten decodiert wird. Zum anderen bleibt offen, ob man die anderen „im Herz“ erreicht. Damit sind deren Orientierungen angesprochen bzw. die Frage, ob die Inhalte der Kommunikation anschlussfähig an die biografischen Orientierungen der Adressierten sind. Beim Beispiel der Sammelmail bleibend gibt der Schulleiter zu bedenken, dass man ja schon nicht davon ausgehen könne, dass alle Adressatinnen und Adressaten eine solche Nachricht läsen. Wem diese Einsicht fehle, dem mangele es auch an Medienkompetenz, die nicht mit technischer Kompetenz zu verwechseln sei bzw. damit nichts zu tun habe. Der Schulleiter verweist die technische Komponente ausdrücklich in den Hintergrund und betont vielmehr die kommunikative Kompetenz i. d. S., dass man sich darüber im Klaren sein sollte, welche Möglichkeiten der Kommunikation unterschiedliche Kommunikationsformen eröffnen, und wie diese von den Adressatinnen und Adressaten rezipiert werden. Das gilt aber für die kopierte und in die traditionellen Postfächer verteilte Mitteilung genauso, und auch im Zuge der persönlichen direkten Ansprache kann man sich nie sicher sein, ob die Kommunikate in der intendierten Weise rezipiert werden. Kommunikation bleibt, egal welches Medium man dazu wählt, immer mit einem Rest Unvorhersehbarkeit behaftet.
Die Nutzung schulspezifischer Software für die schulorganisatorische Kommunikation
Viele digitale Medien, die in der Schule für die Lern- und Lehrprozesse genutzt werden, wurden nicht speziell für diesen Nutzungskontext entwickelt. Anders Schulverwaltungssoftware: Als der Interviewer von den beiden Schulleitungsmitgliedern wissen möchte, welche Rolle die digitalen Medien im Zuge der schulorganisatorischen Kommunikation spielen, lenkt Frau Krause die Gruppendiskussion auf ihre Arbeit mit einem Softwareprogramm zur Erstellung von Vertretungsplänen. An dieser Stelle weist die Gruppendiskussion im Vergleich zum bisherigen Verlauf auch ein deutlich höheres Maß an Selbstläufigkeit auf, was darauf hindeutet, dass die Nutzung digitaler Medien in originär schulorganisatorischen Kontexten für die beiden Lehrkräfte große Orientierungsrelevanz besitzt (Gruppe Birke, Passage „Papier ist in mancher Situation unverzichtbar“).
Frau Krause gibt zu verstehen, dass die digitalen Medien für ihre Arbeit selbstverständlich eine Rolle spielen, so z. B. bei der Erstellung des Vertretungsplans. Morgens um sieben Uhr erstellt sie den Plan für den jeweiligen Tag. Im B-Trakt des Schulgebäudes wird der Plan über das digitale „Schwarze Brett“ publiziert. Konventionell sind Schwarze Bretter vor allem Pinnwände, über die Informationen mitgeteilt werden. Im besagten Teil der Schule wird der aktuelle Vertretungsplan stattdessen auf Monitoren angezeigt. So hat die Lehrerin zum einen weniger Arbeit bei der Erstellung des Plans und muss zum anderen nicht mehr im Gebäude umherlaufen, um diese Informationen aufzuhängen, sodass mit der Medienpraxis ein doppelter Rationalisierungseffekt einhergeht. Auch die anderen Gebäudeteile sollen mit solchen Monitoren ausgestattet werden. Neben der erforderlichen Arbeit möchte sie so auch den „Papierkram“ reduzieren, sodass diese papierbasierten Kommunikate im Sinne von Gerümpel oder Krempel verzichtbar sind.
Im Umkehrschluss möchte sie dagegen Urlaubsanträge der Lehrkräfte (die dann wiederum eine Vertretung erfordern) nach wie vor in Papierform erhalten. Sie bekomme aber auch gelegentlich E-Mails von ihren Kolleginnen und Kollegen, in denen sie ihr z. B. mitteilen, dass sie am nächsten Tag nicht in der Schule sein können. Der Aufwand, um solche Kommunikate weiterzuverarbeiten ist erheblich. Wenn Frau Krause eine solche E-Mail erhält, müsse sie diese ausdrucken oder an einem speziellen Ort speichern. Sie sieht sich entweder gezwungen, das erhaltene Kommunikat in das von ihr präferierte Format zu konvertieren, was einen Mehraufwand mit sich bringt. Oder wenn sie die E-Mail auf ihrem Computer speichert, müsse sie sich merken, dass sie diese dort abgelegt hat, da sie die Information anschließend in das Softwareprogramm zur Erstellung des Vertretungsplans übertragen muss. Die papierbasierten Mitteilungen kann sie wahrscheinlich stattdessen an einer sichtbaren Stelle ablegen und je nach Dringlichkeit in das Programm einarbeiten. Dafür müssen die Lehrkräfte Frau Krause das Kommunikat in der für sie am effizientesten nutzbaren Form zur Verfügung stellen. Damit einher geht die Annahme, dass der Arbeitsaufwand für die einzelne Lehrkraft überschaubar ist und für sie um ein Vielfaches größer sei, wenn sie diese Arbeit für jede der insgesamt rund 120 Lehrkräfte der Schule übernähme. Dazu kommt, dass sie letztlich 2.500 wöchentliche Unterrichtstunden verwalten müsse, sodass sie im Umkehrschluss für jede Form der Rationalisierung dieser Handlungspraxis dankbar ist. Es würden sich aber auch Eltern an Frau Krause wenden, um beispielsweise zu erfahren, wer ihr Kind im nächsten Schuljahr unterrichtet. Für die Lehrerin ist nicht nachvollziehbar, warum Eltern das wissen wollen, trotzdem muss sie auch Zeit für solche, aus ihrer Sicht sinnlosen Anfragen aufwenden und darüber kommunizieren. Herr Zieber erwidert darauf, dass es doch „schön“ sei, solche Fragen zu beantworten, macht mit seinem abschließendem Lachen aber deutlich, dass er eine solche Anfrage für genauso überflüssig hält, wie seine Kollegin. Abschließend weist sie solche Anfragen noch einmal deutlich zurück. Am Ende dieser Sequenz weist Frau Krause darauf hin, dass sie „den Faden verloren“ habe und eigentlich etwas anderes erzählen wollte, sodass dieser letzte Aspekt für sie keine besondere biografische Relevanz besitzt. Wichtiger ist eine vergleichende Bewertung der Vor- und Nachteile des Handelns mit analogen und digitalen Medien (Gruppe Birke, Passage „Papier ist in mancher Situation unverzichtbar“).
Frau Krause geht davon aus, dass aller Wahrscheinlichkeit nach das „Digitalisieren an vielen Stellen sinnvoll […] und auch einfacher“ sei. Die Praxis des Digitalisierens bildet einen Gegenhorizont zur Arbeit mit Papier, ohne dass die Lehrerin bestimmte unter dem Begriff des Digitalisierens versammelte Praxen weiter elaboriert oder exemplifiziert. Der Einsatz der digitalen Medien ist zum einen zweckmäßig („sinnvoll“) und unterliegt insofern auch dem Rationalisierungsparadigma. In die gleiche Richtung zeigt ihr Hinweis, dass diese Form der Praxis „einfacher“ sei, d. h. Mühen reduziert. So benötigt man z. B. weitaus weniger Platz, um eine bestimmte Menge von Daten auf einer CD zu speichern als diese ausdrucken und irgendwo zu lagern. Solche Rationalisierungseffekte laufen aber Gefahr, durch Mehraufwände verloren zu gehen, die das Handeln mit digitalen Medien begleiten. So bräuchte man z. B., um mit den auf einer CD gespeicherten Daten zu arbeiten, spezielle Programme, die eventuell zwischenzeitlich ein Update erfordern, das man ggf. erst durchführen muss, bevor man mit der eigentlichen Arbeit beginnen kann. Bei der Nutzung des „Stundenplanprogramms“ könne es zudem passieren, dass die „Kennziffer“ nicht mehr stimme, sodass bestimmte Informationen erst zur Verfügung gestellt werden müssen, bevor man mit den digitalen Daten arbeiten kann. Deshalb, so Frau Krauses Zwischenkonklusion, müsse noch einiges getan werden. Sie identifiziert einen Handlungsbedarf, den Grad der Zuverlässigkeit der Arbeit mit digitalen Medien dahingehend zu erhöhen, dass der Umfang von Tätigkeiten, die der Arbeitsvorbereitung und nicht der eigentlichen Arbeit mit den digitalen Medien dienen, reduziert wird.
Solche Schwierigkeiten hindern sie nicht daran, täglich den Vertretungsplan der Schule für ihre Kolleginnen und Kollegen online zu veröffentlichen. Diese Handlungspraxis ist selbstverständlich, wiederholt sich täglich und ist i. d. S. inkorporiert. Zum Zeitpunkt der Gruppendiskussion gibt es allerdings aufgrund der stattfindenden „Wanderwoche“ keinen Vertretungsplan. Aufgrund dieser temporären Veränderung müssen sich die Lehrkräfte ggf. selber um eine Vertretung ihres Unterrichts kümmern. Herr Zieber differenziert Frau Krauses Erzählung dahingehend, dass sie damit den „Versuch“ thematisiere, die digitalen Medien über das etablierte Maß hinaus („zusätzlich“) zu nutzen, indem die Lehrkräfte von Zuhause aus den jeweils aktuellen Vertretungsplan einsehen. Anscheinend geht diese noch nicht etablierte bzw. abschließend legitimierte Praxis von der Schulleitung aus, denn die Lehrkräfte „können“ den Vertretungsplan von Zuhause aus einsehen, müssen das aber offensichtlich nicht. Dem gehe die „Anforderung“ voraus, E-Mails bereits am Morgen zu lesen, bevor sich die Pädagoginnen und Pädagogen auf den Weg in die Schule machen. Da zwischen dem Betrachten des Vertretungsplans und dem Abrufen von E-Mails kein direkter Zusammenhang besteht, thematisiert der Schulleiter hier die prinzipielle Möglichkeit, schulische Informationen von Zuhause abzurufen. Bei „jungen Leuten“ gebe es das auch schon, sodass an dieser Stelle auch eine generationelle Komponente zum Tragen kommt. Zumindest für jüngere Lehrkräften sei es teilweise bereits selbstverständlich, schon am Morgen mit Hilfe der digitalen Medien zu kommunizieren. Frau Krause verifiziert diese Vermutung des Schulleiters mit dem Hinweis, dass viele Lehrkräfte den Vertretungsplan schon früh am Morgen in Augenschein nähmen. Ein weiterer Bereich der Schulorganisation und -kommunikation, in dem die digitalen Medien eine wichtige Rolle spielen, ist die Stundenplanung. Diese gehört, wie oben ausgeführt, zu den Hauptaufgaben von Frau Krause. Der Schulleiter thematisiert den Einsatz entsprechender Software. Entlang dieses Themas erreicht die Gruppendiskussion gleichzeitig ihr höchstes Maß an Selbstläufigkeit, sodass diese Thematik hohe (berufs-)biografische Relevanz für die beiden Schulleitungsmitglieder hat (Gruppe Birke, Passage „Aktueller Stundenplan“).
Herr Zieber vermutet, dass die „Frage der verschiedenen Programme“, die für die Schulverwaltung eine wichtige Rolle spielen, eventuell „spannend“ sein könnte. Mindestens Teile des Schulbetriebs ruhen auf mehreren Softwareprogrammen. Abermals richtet der Schulleiter seine Ausführungen an den vermuteten Interessen der Interviewer aus. Im angesprochenem Kontext ist zwischen Softwareprogrammen zu unterscheiden, die die Schule nutzen muss, und solchen, die sie ausgewählt hat. Zur letzteren zählt auch das SIS (OrgaTec). Zur ersten Gruppe gehört die SchuDaba (Schul-Datenbank). Dazu kommt mit „ProPlan“, ein Programm zur Erstellung von Stundenplänen. Insgesamt nutze man mehrere Programme „nebeneinander“, d. h., die Anwendungen kommen gleichzeitig zum Einsatz. Das Zusammenspiel der verschiedenen Programme i. S. ihrer Überführ- und Verknüpfbarkeit sei zumindest partiell („teilweise“) sehr ungenügend, sodass die technischen Arbeitsvorausset- zungen mangelhaft sind. Er geht davon aus, dass das auch ein hoch bedeutsamer Aspekt für die Interviewer sei, was vom Interviewer bestätigt wird.
Frau Krause weist darauf hin, dass es prinzipiell eine Möglichkeit gebe, Daten aus der SchuDaba in das Programm ProPlan zu exportieren. Damit scheint eines der von Herrn Zieber angedeuteten Probleme konkretisiert zu sein. Die Lehrerin nutzt diese Möglichkeit aber nicht, da ihr die nötige Überzeugung fehlt, dass diese adäquat funktioniert. Herr Zieber unterbricht sie mit dem Hinweis auf „Erfahrungen“ und „Kinderkrankheiten“. Erfahrungen sind Kenntnisse oder Einsichten, die durch wiederholte Wahrnehmung und/oder Übung erlangt werden. Die Erfahrung verweist aber auch auf Prozesse des Durchmachens und/oder Erleidens. In Zusammenhang mit Kinderkrankheiten, die synonym für Probleme einer Anfangsphase stehen, paraphrasiert der Schulleiter hier erhebliche negative Praxiserfahrungen. Angesprochen sind mögliche Schwierigkeiten, die generell mit der initialen Nutzungsphase einer Software assoziiert werden. Frau Krause fährt fort, dass es sich schlicht um Erfahrungen handelt, die man im Zuge der Arbeit mit der SchuDaba gemacht habe. Vollkommen zufriedenstellend wäre es, wenn sie Daten aus dem Programm ProPlan in die SchuDaba exportieren könnte. Denn anders als im Fall der Arbeit mit der SchuDaba geht sie davon aus, dass die Daten, die sie in ProPlan gespeichert hat, „gut“ seien, d. h., sie erfüllen im positiven Sinne bestimmte Qualitätsmerkmale. Herr Zieber argumentiert ähnlich, dass diese Daten „verlässlich“ seien, d. h., sie verfügen über ganz bestimmte sichere Eigenschaften im Gegensatz zu den Daten der SchuDaba.
Frau Krause fährt fort und verweist auf eine mehrere Jahre zurückliegende Tagung, an der sowohl Vertreterinnen bzw. Vertreter der Firmen, die die Programme ProPlan und SchuDaba herstellen, teilnahmen. Herr Zieber ergänzt die beginnende Erzählung dahingehend, dass die SchuDaba zu diesem Zeitpunkt „ein absoluter, also der Ultraskandal“ gewesen sei. Die Einführung der Datenbank markierte demnach ein weit über das übliche Maß hinausgehendes anstoß- bzw. aufsehenerregendes Vorkommnis. Nunmehr sei die Datenbank „nur noch ein Skandal“, d. h., Grund zum Anstoß gibt sie immer noch. Frau Krause teilt die harsche Kritik ihres Kollegen und stellt im Zuge der weiteren Erzählung eine direkte Verbindung zwischen der geäußerten Kritik an der Datenbank und dem Auftreten einer Vertreterin bzw. eines Vertreters der SchuDaba her. Der Mitarbeiter von ProPlan, habe sich „professionell“ präsentiert, so wie man es sich „wünscht“, d. h., er trat fachmännisch und berufsmäßig auf, wie man es im Allgemeinen erwarte.
Im Gegensatz dazu sei der SchuDaba-Vertreter „furchtbar“ gewesen, sodass sich ein maximaler Kontrast auftut. Dass sich Frau Krause trotz der vergangenen Zeit noch detailliert erinnert, spricht für die biografische Relevanz des Ereignisses. Der Schulleiter führt die Schwierigkeiten mit der SchuDaba weiter aus (Gruppe Birke, Passage „Aktueller Stundenplan“).
Herr Zieber erklärt, dass auch die Nutzung von OrgaTec auf der Verfügbarkeit einer Schnittstelle aufbaut und dass an dieser Stelle letztlich „Vereinbarungen nicht eingehalten“ wurden. Sie wurden zwischen dem Unternehmen Top-IT, das das SIS entwickelt hat und „auch sehr viel investiert“ hat, sowie dem „Ministerium“ getroffen. Der Hinweis auf die sehr umfangreichen Investitionen von Top-IT unterstreicht noch einmal die positive Beurteilung des Unternehmens durch die beiden Lehrkräfte. Im Umkehrschluss wurde vom Kultusministerium des betroffenen Bundeslandes nichts investiert bzw. nicht einmal die Zusage eingehalten, den Datenaustausch zwischen SchuDaba und OrgaTec zu ermöglichen. Das, so der Schulleiter weiter, sei eine „sehr spannende Geschichte“, d. h. ein ein besonderes Interesse erregendes Vorkommnis. Aufgrund der fehlenden Schnittstelle sei OrgaTec „inzwischen […] in vielen Bereichen ein Ärgernis“, d. h., die Arbeit mit dem SIS ruft an vielen Stellen Verdruss bei den Lehrkräften hervor. Das könne man aber nicht dem Unternehmen anlasten, das für die Probleme genaugenommen keine Verantwortung trägt. Gleichwohl scheint es zumindest ansatzweise hypothetisch für das Unternehmen möglich, etwas zu tun, ohne dass Herr Zieber diesen Punkt weiter ausführt. Die Folge davon sei das Entstehen „einer schiefen konzeptionellen Situation“, d. h., die dem SIS zu Grunde liegenden programmatischen Entwürfe lassen sich nicht mehr in der ursprünglich beabsichtigten Weise umsetzen. Die angesprochenen Veränderungen hätten u. a. zur Folge, dass man sich damit „abgefunden hat, dass man bestimmte Dinge nachfriemeln muss oder von Hand machen muss“. Das mit dem Einsatz von Software regelmäßig verbundene Rationalisierungsparadigma wird ausgehebelt, da die Einschränkungen durch die fehlende Interoperabilität zur Folge haben, dass bestimmte Praxen manuell (von Hand) durchgeführt werden müssen, die ansonsten automatisiert ablaufen würden. Aus diesen Gründen sei das Programm „ein Flickwerk“, d. h. eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Komponenten, die nur bedingt zusammenpassen. Das habe wiederum zur Folge, dass man dann „auch nicht mehr den wirklichen Wunsch zur Optimierung oder so etwas“ habe. In diesem Sinne führen die beschriebenen Schwierigkeiten zu einer ansatzweisen Resignation bzw. zu Akzeptanz auf niedrigem Niveau.
Auch die Struktur des Schulwesens im Bundesland der Schule spielt im beschriebenen Kontext eine Rolle. Die dortigen „Schulformen und Strukturen“ seien „sehr unterschiedlich“, sodass die innere und äußere Gliederung der Organisation der Schulen erheblich variieren. So unterscheidet sich z. B. an den Gesamtschulen die Organisation der Lerngruppen, der Kurssysteme und ähnlicher Systeme deutlich von anderen Schulformen. Die Schule als Organisation besteht i. d. S. in ihren Teilbereichen aus funktionalen Einheiten, die aus mehreren Einzelteilen bestehen, die zur Durchführung des Lern- und Lehrbetriebs erforderlich sind. Dazu kommen noch ‚Begrifflichkeiten‘, d. h., dass ähnliche oder gleiche Bestandteile unterschiedlicher Schulen gleicher Schulform verschieden benannt sind, sodass man mit diesen Begriffen vertraut sein muss, um gleiche Organisationsbestandteile zusammenfassen zu können bzw. sie in gleicher Weise im Zuge der Softwareprogrammierung abzubilden, auch wenn sie verschieden bezeichnet sind.
Diese, die Organisation der Schule mitbegründenden „eigentlich logische[n] Konzept[e] und die Struktur[en]“ müsse man „verstanden haben“, bevor man Datenbanken für Schulen programmieren kann. Um in der Schule einsetzbare Software zu entwickeln, ist es erforderlich, zunächst zu begreifen, welche in Wirklichkeit schlüssigen Pläne und/oder Programme sowie äußere und innere Gliederungen die Handlungspraxis in der Schule begründen. Im Sinne der Softwareentwick- lung geht es dabei um eine adäquate Prozessanalyse und -modellierung. Bei der Entwicklung der SchuDaba wurden diese Voraussetzungen nur unzureichend berücksichtigt und u. a. wurde ignoriert, dass eine integrierte Gesamtschule nur innerhalb bestimmter Festlegungen funktioniert. So könne man z. B. nach wie vor die Ergebnisse bestimmter Prüfungen nicht in der SchuDaba erfassen, weil die erforderliche technische Umsetzung dafür ausgeblieben ist und die Struktur einer IGS in dem System nicht abgebildet wurde.
Zusammenfassung
Die beiden Mitglieder der Schulleitung nutzen die digitalen Medien in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten ihrer Arbeit. Die Stundenplanung wäre z. B. ohne entsprechende Software kaum noch möglich. In einzelnen Bereichen der schulorganisatorischen Kommunikation sind die digitalen Medien alternativlos. Die papierbasierten Kommunikate erweisen sich dort als nicht mehr adäquat und nicht zuverlässig genug für die Arbeit vor dem Hintergrund einer sich verändernden und zunehmend mediatisierten Organisationskultur. Dazu kommen neue Orien- tierungsschemata i. S. sich wandelnder Konventionen der Kommunikation, die aufs Engste mit der Nutzung digitaler Medien verbunden sind. Bisher konzentrieren sich diese Veränderungen vor allem auf den Bereich der Schulverwaltung. Im Kontext der dort anfallenden Arbeiten ist Frau Krause für jede Form der Rationalisierung dankbar, egal auf welchen Medien sie basiert. Die Schul-Datenbank (SchuDaba) erfüllt allerdings nicht die dafür erforderlichen Voraussetzungen und die Nutzung wird von erheblichen negativen Praxiserfahrungen begleitet. Da diese Daten auch für die Arbeit mit OrgaTec benötigt werden, beeinträchtigt die schlechte Qualität der SchuDaba auch die Arbeit mit dem SIS. Diese Probleme führen bei den beiden Schulleitungsmitgliedern zur ansatzweisen Resignation und Akzeptanz der angesprochenen Systeme auf niedrigem Niveau, u. a. weil aus dem Kultusministerium als (mit-)verantwortlicher Instanz in dieser Frage keine Hilfe zu erwarten ist, sondern im Gegenteil dort (Mit-)Verursacher der Problematik verortet werden.
Papierbasierte Kommunikate sind nach wie vor ein wichtiger Träger der schulorganisatorischen Kommunikation. Denn sie besitzen zum einen ein relativ hohes Rationalisierungspotenzial. Zum anderen gewährleisten sie das für bestimmte Kommunikationen erforderliche Maß an Zuverlässigkeit. Dagegen kann der Schulleiter z. B. die Lehrkräfte nicht verlässlich per E-Mail erreichen, da sie nicht verpflichtet sind, ihr E-Mail-Postfach regelmäßig auf den Eingang dienstlicher Kommunikate hin zu überprüfen. Im Zentrum seiner (berufs-)biografischen Orientierungen steht ohnehin die interpersonale direkte Kommunikation, u. a. weil sie am verbindlichsten ist. Die Unterstützung der Lehrkräfte durch den Schulleiter wird z. B. erst durch ihren sichtbaren Vollzug, d. h. auf der Basis interpersonaler direkter Interaktionen leibhaftig erfahrbar. Insofern haben die materiellen Anteile der Kommunikation eine große Bedeutung für deren Qualität und Verbindlichkeit. Mittels regelmäßiger physischer Präsenz im zentralen Lehrerzimmer der Schule signalisiert der Schulleiter außerdem seine permanente Ansprechbarkeit und schafft Vertrauen.
Insbesondere an der Schnittstelle zwischen schulinterner und -externer Kommunikation (mit Akteuren außerhalb der Schule) vollzieht sich die kommunikative Praxis auf einer formellen, durch externe Orientierungsschemata vorgegebenen und einer informellen Ebene, die vom informellen Vertrauensverhältnis zwischen dem Schulleiter und den Pädagoginnen und Pädagogen geprägt ist und einen gemein- samen Orientierungsrahmen schafft, der die Grundlage zur handlungspraktischen Bewältigung der im Schulalltag anstehenden Aufgaben liefert. Verbindlichkeit wird außerdem vor allem durch die Art und Weise bestimmt, wie man miteinander kommuniziert, ohne an eine bestimmte Form gebunden zu sein. Gleichwohl ist die Face-to-Face-Kommunikation i. d. S. am verbindlichsten.
Fußnote:
[1] In diesem Fall handelt es sich um eine handschriftlich angefertigte Liste mit den Namen von Lehrkräften, die bereit gewesen wären, an einer Gruppendiskussion teilzunehmen. Die Liste taucht im Rahmen der Feldforschung nicht wieder auf, und es konnten auch so viele Personen für Gruppendiskussionen gewonnen werden, wie auf der Liste standen.
Mit freundlicher Genehmigung des VS Verlages.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-03677-5_3
Nutzungsbedingungen:
Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, bzw. nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt – es darf nicht für öffentliche und/oder kommerzielle Zwecke außerhalb der Lehre vervielfältigt, bzw. vertrieben oder aufgeführt werden. Kopien dieses Dokuments müssen immer mit allen Urheberrechtshinweisen und Quellenangaben versehen bleiben. Mit der Nutzung des Dokuments werden keine Eigentumsrechte übertragen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.