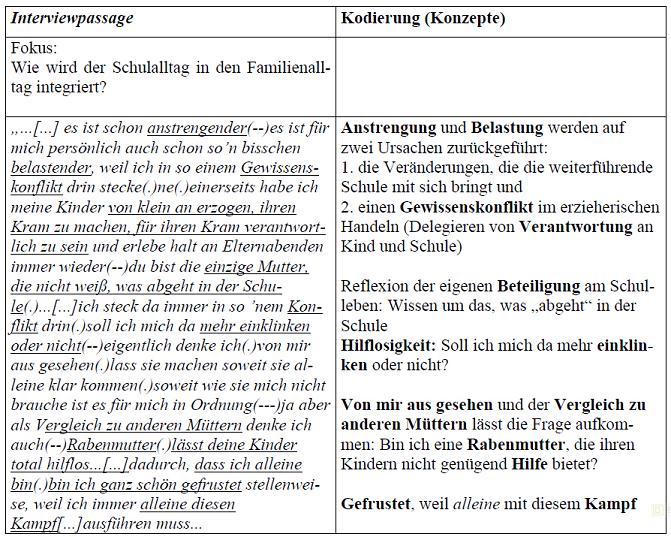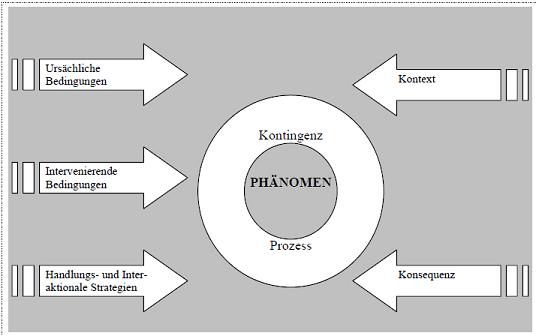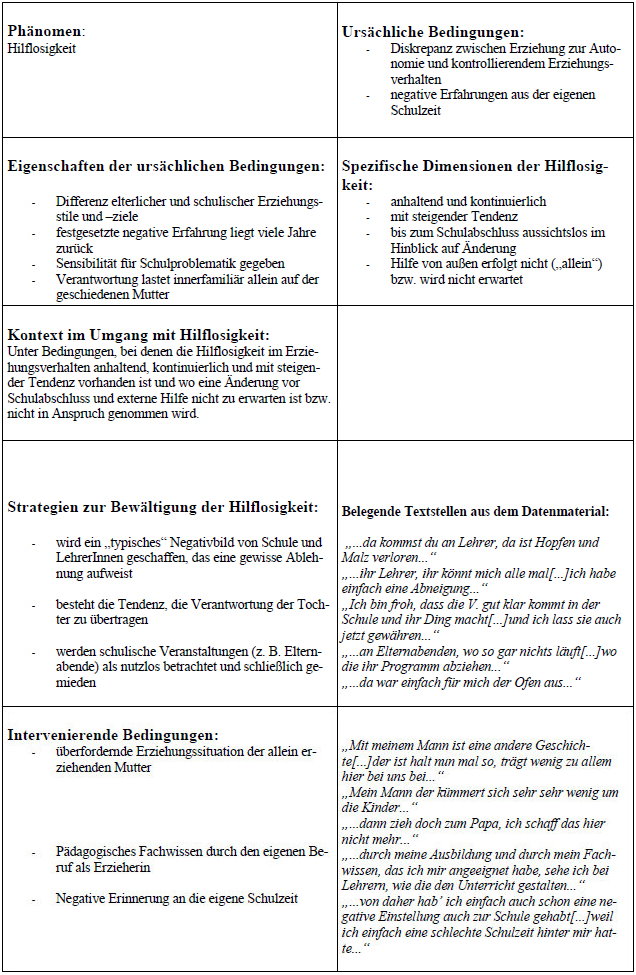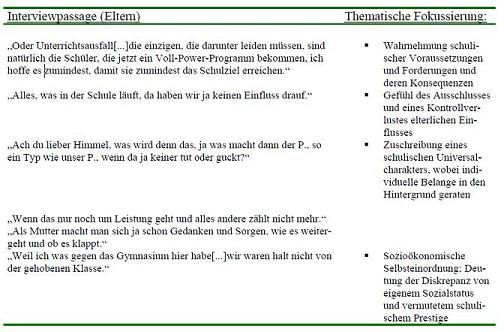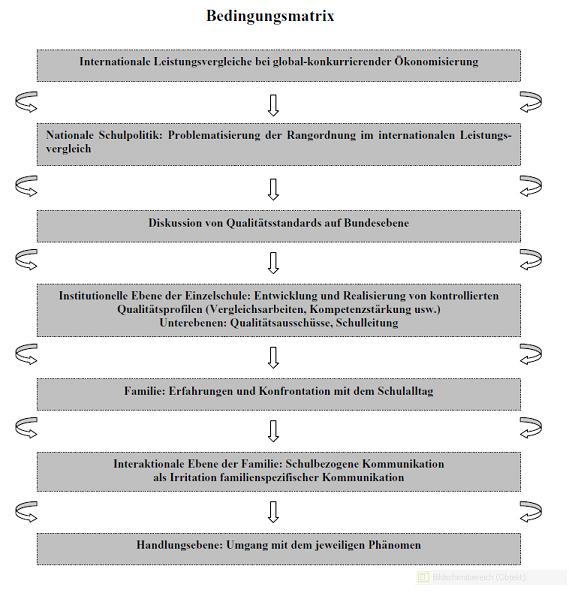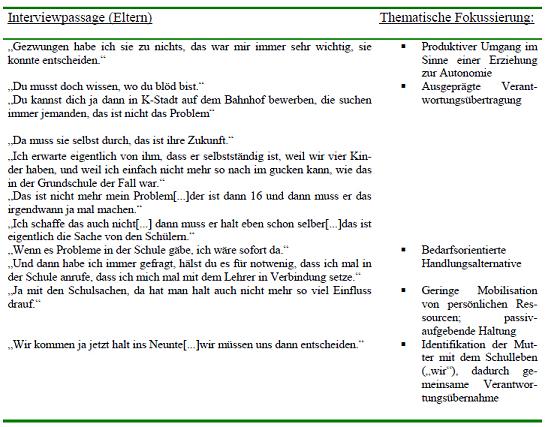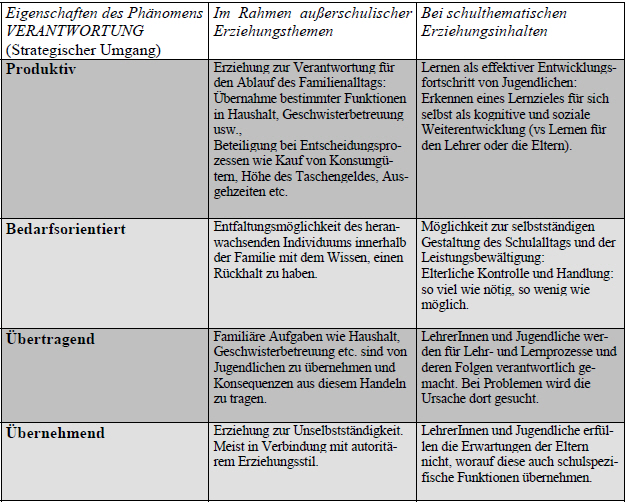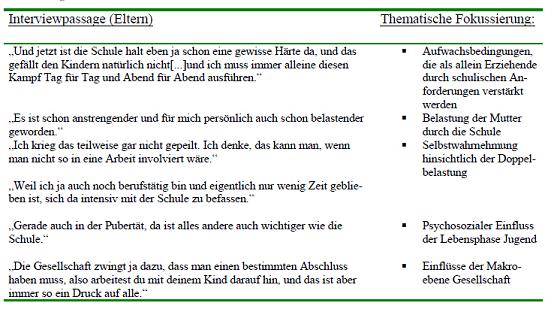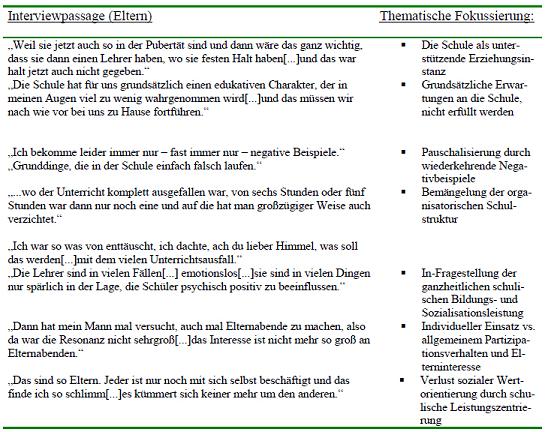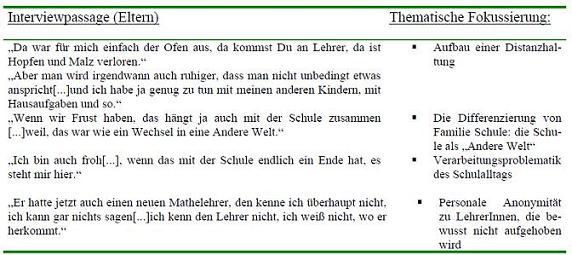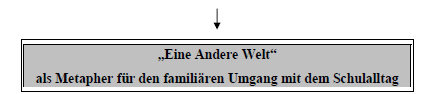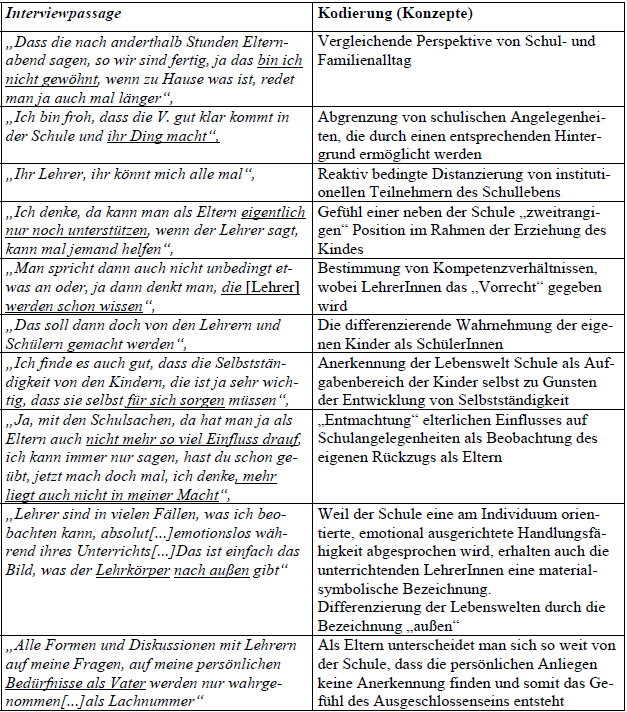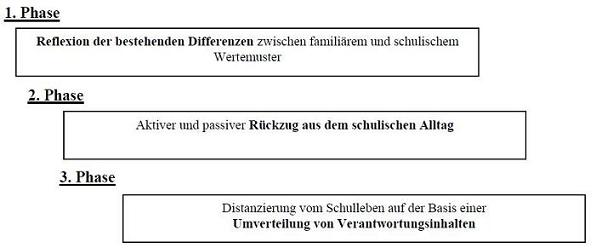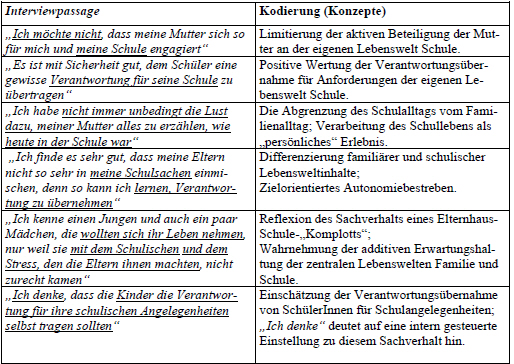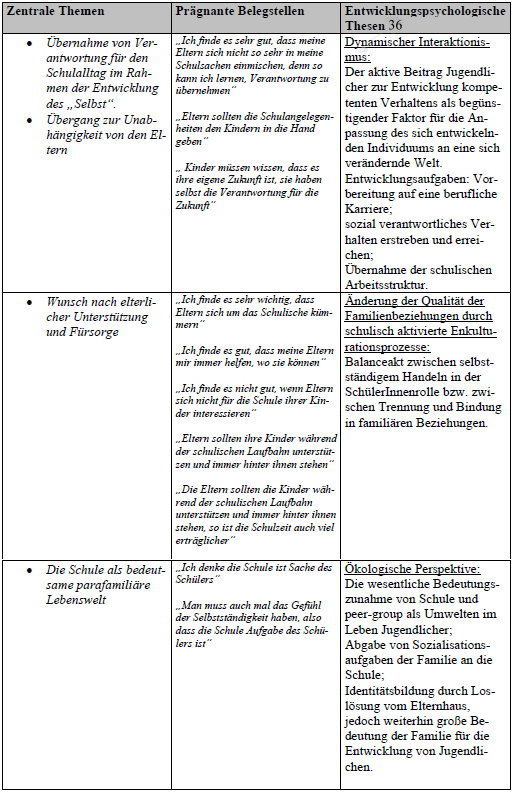Auszug aus der Dissertationsschrift Wie eine andere Welt – Eine Grounded Theory-Studie zur Frage der Teilhabe von Eltern an schulischer Kommunikation am Beispiel von RealschülerInnen. Die Nummerierung wurde auf Grund der zahlreichen Querverweise beibehalten.
Fallrekonstruktion der Interviews und Aufsätze
7.1 Auswertung der Daten nach der Grounded Theory:
Analysebeispiel eines Elterninterviews
Die Datenanalyse nach dem Interpretationsstil der Grounded Theory (Glaser/ Strauss 1967/1996; Strauss/ Corbin 1990/ 1996; Strauss 1994) erfolgt, wie im vorherigen Kapitel ausführlicher erläutert, nach dem Grundprinzip der Entwicklung eines kategorialen Deutungsrahmens für ein bestimmtes Untersuchungsphänomen. An dieser Stelle sollen nun Daten von Eltern und SchülerInnen anhand von Analysebeispielen kodiert werden. Dabei zeichnet sich ein schematisches Vorgehen ab, welches von Beginn dieses Prozesses an unterstützend auf die spätere Theorieentwicklung wirkt.
Das folgende Analysebeispiel wird durchgehend an einem Datenausschnitt eines Elterninterviews präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei die in allen Interviews einführende Frage nach dem Umgang der Eltern mit dem schulischen Lebensalltag innerhalb des Familienalltags.
Um das Verständnis der Leserin bzw. des Lesers zu fördern, möchte ich die Arbeitsschritte der Datenanalyse für jede Kodierart veranschaulichen, die auch während der tatsächlichen Datenanalyse nach der Methode der Grounded Theory erfolgt. Der hier als chronologisch dargestellte Ablauf von offenem, axialem und selektivem Kodieren gestaltet sich in der Forschungsrealität als zirkulärer Prozess.
Die eigentliche, hier nicht dokumentierte Analysetätigkeit beginnt jedoch bereits mit dem Notieren von Kode-Notizen, die als anfängliche Namen für bestimmte Ereignisse im Datenmaterial direkt an den Rand der Dokumente geschrieben werden können. Es folgen schließlich weitere Stufen der Ausformulierung, die die entdeckte „Hauptidee“ (Strauss/ Corbin 1996, 54) anschließend immer weiter spezifizieren und bereichern.
7.1.1 Der Erzählimpuls für das Elterninterview – Ein Interpretationsversuch
Wie bei den Erzählstimuli, die den 16 SchülerInnen in Form von Statements Gleichaltriger vor der Erstellung ihrer Aufsätze gegeben wurden (6.5.4) soll nun eine Interpretation für den Gesprächseinstieg, der den Elterninterviews diente, gegeben werden. Dazu wird eine schrittweise Deutung sowohl für den einleitenden Stimulus als auch die Inhalte des Leitfadens vorgenommen. Eine Eingruppierung der verschiedenen Fälle wird im Sinne der Grounded Theory dadurch vollzogen, ähnliche Fälle durch entsprechende oder gleiche Kategorien und deren Analyse zu gruppieren bzw. durch abweichende Kategorien zu differenzieren. Dadurch wird –wie in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben– nicht der Einzelfall behandelt, sondern eine Theorie anhand von Kategorien und schließlich einer Hauptkategorie entwickelt.
Der Gesprächseinstieg „Ihre Tochter/ Ihr Sohn besucht ja jetzt die 8. (9.) Klasse der Realschule. Erzählen Sie doch mal über sich als Vater/ Mutter dieses Schulkindes.“
Leitfaden
• Wie sehen Sie sich Eltern als Mutter/ Vater von SchülerInnen?
• Wodurch entstehen Spannungen und Konflikte im Eltern-Kind-Verhältnis, die auf die Schule zurückzuführen sind?
• Welche Möglichkeiten der Beteiligung am Schulleben des Kindes werden wahrgenommen?
• Bestehen Erwartungen oder gar Ängste bezüglich der Bewältigung des Schulalltags?
• Die persönliche Sichtweise zur Wertigkeit von Schule und Bildungsabschluss.
• Abschließend die Aufforderung, ein Resümee des Erzählten zu ziehen.
7.1.2 Das Benennen von Phänomenen beim offenen Kodieren
Der Vorgang des „offenen Kodierens“ beginnt mit einer eingehenden Untersuchung der Daten, um im weiteren Verlauf schließlich Phänomene benennen und kategorisieren zu können (1). Hierzu wird der Text des vorhandenen Datenmaterials satz- und abschnittsweise analysiert und solchen Ereignissen Namen zugeordnet, die als Phänomen hervortreten. Während dieses Vorgangs, der als erster Schritt des Analyseprozesses im Rahmen des offenen Kodierens als Konzeptualisierung bezeichnet wird, „…werden die Daten in einzelne Teile aufgebrochen, gründlich untersucht, auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin verglichen, und es werden Fragen über die Phänomene gestellt, wie sie sich in den Daten widerspiegeln…“ (Strauss/ Corbin 1996, 44).
Durch eine komparative Analyse (das Vergleichen von Konzepten, die sich offenbar auf ein ähnliches Phänomen beziehen) wird schließlich wird eine Klassifikation von Konzepten erreicht, die eine höhere Ordnung auf abstrakterer Ebene von Konzepten darstellt. Eigenschaften und Dimensionen von Kategorien werden anschließend auf ihre Beziehungen untereinander untersucht und angeordnet.
Das hier illustrierte Analysebeispiel zeigt Konzepte, die als grundlegende Bausteine der Theorie herausgearbeitet wurden. Sie entstammen überwiegend aus Worten und Äußerungen der Informantin selbst. Als „In-Vivo-Kodes“ stellen sie somit eine wichtige Quelle für die Vergebung der konzeptionellen Namen dar (2).
Abb. VII.1 Kode-Notiz: Wie wird der Schulalltag in den Familienalltag integriert?
Zu diesem Kodierausschnitt wurden folgende Memos (3) verfasst:
Anstrengung und Belastung durch die Schule werden in diesem Fall sehr offensichtlich als persönliches Erleben einer Mutter geschildert, während andere Interviewpartner die Belastung mehr indirekt zum Ausdruck bringen oder als „geteiltes Leid“ von Kind und Eltern ansehen.
Belastung durch die Schule wird auf zwei Ebenen begründet: einmal durch Veränderungen, die die weiterführende Schule mit sich bringt (deutlich wird dies durch Verwendung des Komparativs: anstrengender bzw. belastender), zum andern durch einen Konflikt, der in einer differenzierten Haltung zwischen notwendiger und hinreichender bzw. erforderlicher Unterstützung schulischer Aktivitäten der Tochter besteht.
Der erwähnte Gewissenskonflikt deutet darauf hin, dass der eigene Erziehungsstil, der im familiären Geschehen seine Anwendung findet, mit dem Erziehungsstil in der Schule konfligiert. Dadurch tritt gleichzeitig eine erzieherische (4) Unsicherheit auf, wie mit dieser Differenz von Stilen bzw. Zielen der Erziehung umgegangen wird. Auch der Vergleich mit anderen Müttern verursacht ein schlechtes Gewissen („…als Vergleich zu anderen Müttern…“). Dieser Vergleich wirft die Frage auf, wie viel Verantwortung notwendig ist und wie viel der Tochter in Sachen Schule zugemutet werden kann und führt zur Eigenbeurteilung einer Rabenmutter, die von ihren Kindern in schulischen Angelegenheiten die Selbstständigkeit abverlangt, die ihnen auch zu Hause zugestanden und auferlegt wird („…lässt deine Kinder total hilflos…“). Im Rahmen des erzieherischen Handelns entsteht dadurch das Gefühl der Hilflosigkeit.
Erziehung wird persönlich als Frustration und Kampf erlebt, besonders, weil das erzieherische Handeln nach ihrer Scheidung von der interviewten Mutter alleine bewältigt werden muss.
Zu beachten ist, dass solche Memos zwar sehr hilfreich sind, aber lediglich als erste Eindrücke der Forscherin anzusehen sind, die als eine Art „Proposition“ Hypothesencharakter haben. Erst im Verlauf der weiteren Konzeptualisierung und im Vergleich mit anderen Daten kann festgestellt werden, wie Phänomene miteinander in Beziehung stehen, ob sie in dieser Form aufrechterhalten werden können oder ob Konzepte vielleicht einen anderen Namen erhalten sollen, der jeweils zutreffender erscheint.
Des Weiteren weisen solche ersten theoretischen Notizen auch eine Richtung für den Prozess der Datenauswahl auf und für Bereiche, die in den folgenden Interviews untersucht und nachgefragt werden sollen (Theoretical Sampling (5)).
Ausgehend von dem theoretischen Memo des oben aufgeführten Beispiels lässt sich als Ergebnis für diese Interviewpassage das zentrale Konzept „Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln der Mutter herausarbeiten. Die komparative Analyse weiterer Fälle aus dem Bereich der Elterninterviews zeigt, dass sich weitere Konzepte unter „Hilflosigkeit“ einordnen lassen, da sie sich auf ein ähnliches Phänomen beziehen. Diese Klassifikation führt schließlich zu einer Anhebung des Abstraktionsniveaus, wodurch „Hilflosigkeit“ auf einer höheren Ordnung, der Kategorie angesiedelt werden kann, die sich als grundlegender Baustein identifizieren lässt. Hierunter können nun verschiedene Konzepte mit ähnlichem Bezugspunkt zusammengefasst werden.
Die Analysetätigkeit ist auch an dieser Stelle als Prozess zu verstehen, wobei diese Arbeit immer wieder durch das Festhalten theoretischer Notizen („Memos“) unterbrochen wird. Das Verfassen von Memos kann, wie es weiter oben in Textform dargestellt wurde, aber auch in Form von Diagrammen als graphische Darstellungen von Beziehungen zwischen Konzepten, Schemata oder anderen Notizen verfasst werden (7.2.1). Dabei variieren Inhalt und Länge der theoretischen Notizen ebenso wie der Abstraktionsgrad je nach Forschungsphase steigt: Beim axialen und selektiven Kodieren ist dieser sehr viel höher als beim offenen Kodieren, das nur erste theoretische, dennoch bereits sensibilisierende Überlegungen und „Auffälligkeiten“ des Datenmaterials widerspiegelt. Mit fortschreitender Analyse werden Memos und Diagramme komplexer: Sie gewinnen an Dichte, Klarheit und Präzision. Innerhalb dieses Prozesses wächst schließlich eine Datenbasis an, die in engstem Bezug zur sozialen Realität die Entwicklung der Theorie vorantreibt.
Mit dem Erstellen von theoretischen Notizen gelingt es der Forscherin bzw. dem Forscher, eine „analytische Distanz“ (Strauss/ Corbin 1996, 170) zum Untersuchungsmaterial einzunehmen. Somit kann ein abstraktes Denken weg von den Daten erreicht werden, um dann wieder zu ihnen zurückzukehren und den Realitätsbezug zum Datenmaterial herzustellen. Die innerhalb sämtlicher Kodierverfahren angefertigten Memos als schriftliche Analyseprotokolle sind somit für das Anfertigen eines sorgfältigen und glaubwürdigen Forschungsberichtes ebenso unverzichtbar wie für das Ausarbeiten der Theorie (6).
Das weiter oben herausgestellte Konzept der „Hilflosigkeit“ im Erziehungshandeln kann nun durch Zuordnung von prägnanten Attributen einer analytischen Verfeinerung unterzogen werden. Eigenschaften stellen dabei die Charakteristika der Kategorie dar, Dimensionen kennzeichnen diese Eigenschaften im Besonderen.
Abb. VII.2 Bezug zur Code-Notiz „Integration des Schulalltags in den Familienalltag“
„Ich steck da immer in so ’nem Konflikt drin(.)soll ich mich da mehr einklinken oder nicht?“
Die neben „Hilflosigkeit“ entwickelten Kategorien dieses Interviews, wie sie oben aufgeführt sind (u. a. Belastung, Verantwortung, Unterstützung etc.) dienen schließlich als weitere Grundlage für das theoretische Sampling und den Fokus, der bei der nächsten Datenerhebung beachtet werden sollte.
Innerhalb dieser Arbeit gestaltete sich das theoretische Sampling zusätzlich dadurch, dass die gefundenen Kategorien zusätzlich auch den „Beobachtungsort“, d. h. typische familiäre Konstitutionen bestimmte, etwa Familien mit mehreren Kindern, allein Erziehende, beruflich Selbstständige usw.
„Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln wird zunächst als zusammenfassende Bezeichnung ähnlichen Ereignissen und Vorfällen übergeordnet. An einigen Beispielen verschiedener Elternaussagen, unter denen Hilflosigkeit ebenfalls festgestellt werden kann, lässt sich zeigen, was dieses Phänomen und seine jeweils differierenden Dimensionalisierungen verdeutlicht. Gleichzeitig soll bei dieser Darstellung das Verfassen der entsprechenden Kode-Notizen zu dem Phänomen in Form von Memos erfolgen, wie es im gesamten Prozess des Kodierens der Fall ist (7). Memos variieren in ihrer qualitativen und quantitativen Ausprägung je nach Forschungsphase, Absicht und Art des Kodierens sowie nach dem Stil der Forscherin oder des Forschers.
An der frühen Stelle des offenen Kodierens wurde für diese Arbeit für eine erste Orientierung hinsichtlich der entwickelten Kategorien in Form von theoretischen Notizen (8) erreicht. Nachdem –das soll hier nicht aufgelistet werden– das Phänomen „Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln, was sich speziell aus der schulischen Situation ergibt, zunächst in jedem Einzelfall hinterfragt und auf Eigenschaften und Dimensionen untersucht wurde, erfolgte der Vergleich für die Aussagen mehrerer Elternteile, um nach weiteren Eigenschaften und Ausprägungen von „Hilflosigkeit“ zu ermitteln.
Die erstellten Memos können zum Zeitpunkt des offenen Kodierens lediglich als erste theoretische Notizen gelten, die sich im fortschreitenden Forschungs- und Analyseprozess weiterentwickeln und konzeptuell an Komplexität gewinnen. Dennoch sind sie für die Forscherin bzw. den Forscher bereits in dieser Phase ein unerlässliches Mittel, das abstrakte Denken über die Daten zu fixieren und einen gewisse analytische Distanz zum Datenmaterial einzunehmen, um daraufhin zu diesem zurückzukehren.
Weiterhin ist es durchaus möglich, dass den in diesem Arbeitsabschnitt herausgefundenen Phänomenen im Laufe der weiteren Beschäftigung mit den Daten eher die Bedeutung einer Bedingung oder eines Kontextes zukommt. Auch zu dieser Differenzierung können die angefertigten Memos erheblich beitragen.
Das Phänomen „Hilflosigkeit im erzieherischen Handeln“ durch den Einfluss des schulischen Lebensalltags:
„Für mich jedenfalls ist das heute doch schon ein bisschen schwieriger, dem Kind dann Unterstützung und Hilfe zu geben […]ich habe Gott sei Dank einen Bekannten, der hat ein Wirtschaftsstudium gemacht. Und zu dem habe ich gesagt, komm hier rüber und mach mit der S. Mathe. Ich krieg die Krise, ich kann ihr nicht helfen. Hinz und Kunz habe ich mobilisiert. Ja, und wegen Englisch dann, da hatte sie auch ihre Probleme mit der Frau – ich weiß nicht wie die heißt – in Englisch kann ich ihr nicht großartig helfen[…]. Ich habe im Osten damals kein Englisch gelernt, da stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch. Ich kann die Vokabeln abfragen, aber wenn es darum geht Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, ich kann es ja dann schon mal gar nicht lesen, dann lacht sie sich kaputt.“
Memo: Wenn in diesem Interview Hilflosigkeit als Phänomen hervortritt, so handelt es sich um eine Form, die sich ausschließlich auf die Unmöglichkeit der schul-fachlichen Hilfestellung zu Hause bezieht. Diese Schulfachlichkeit stellt eine spezifische Eigenschaft dar. Die Hilflosigkeit der Mutter ist dann besonders groß, wenn es um Fächer geht, in denen sie aus bestimmten Gründen nicht ausreichend gebildet ist. Wenn die Möglichkeit besteht, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, so wird dies getan, was zur Erleichterung führt („Gott sei Dank“).
„Teilweise fühle ich mich da schon ziemlich hilflos und machtlos gegenüber den schulischen Einflüssen, die da von außen auf die Kinder eintreffen. Wenn der J. dann so erzählt mit dem Rauchen und so. Ich meine, wenn er damit anfängt, dann ist es so, dann kann ich es nicht ändern. Also wir rauchen zu Hause nicht und von daher denke ich oder hoffe, dass er es lässt[…]aber wenn es dann Drogen werden oder, also dann hoffe ich nicht, dass er da rein gerät. Ja und ich meine, das fängt ja oft in der Schule an[…]ich denke, wenn sie es wirklich wollen, dann erzählen sie es zu Hause nicht[…]solche Sachen kommen dann zu Hause nicht mehr an[…]da hat man dann als Eltern keinen Einfluss mehr drauf.“
Memo: Hilflosigkeit wird in diesem Fall ausgelöst durch die Angst, dass der elterliche Einfluss durch schulinternes Geschehen (das Verhalten und Handeln der MitschülerInnen) verloren gehen könnte und der Sohn dem Einwirken der Gleichaltrigen ausgesetzt ist, die in der Schule mit ihm zusammen sind. Unter der Bedingung, dass die Eltern unaufgeklärt über bestimmte Vorfälle bleiben (z. B. Drogenkonsum), verstärkt sich das hilflose Gefühl. Im Gegenzug dazu verringert es sich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Sohn die Elternhausstrukturen („Wir rauchen zu Hause nicht“) übernimmt.
„Wir haben den Vorteil, dass meine Frau wie auch ich, dass wir beide gut ausgebildet sind. Wir sind in der Lage, uns zeitlich mit den Kindern zu beschäftigen, und wir sind auch in der Lage, die Aufgabenstellung der Schule umzusetzen. Das heißt, eigentlich ist das für uns eine runde Situation, die nicht viele haben zu Hause.“
Memo: Beim Analysieren dieses Datenausschnittes fällt auf, dass die defizitären schulischen Angelegenheiten, die von dem Schüler mit nach Hause gebracht werden, nicht wie in den anderen Fällen zu einem hilflosen Verhalten führen, sondern im Gegensatz dazu eigene Gegebenheiten aktiviert werden. Die Bedingung „gute Voraussetzungen im Elternhaus durch motivierte und fähige Eltern“ führt also zu einer Beseitigung der Hilflosigkeit: Je mehr die Eltern selbst dazu beitragen können, zu Hause die Lücken schulischer Gegebenheiten zu füllen, desto weniger kommt das Gefühl der Hilflosigkeit zu tragen.
Für die Vielzahl der verschiedenartigen Memos, die man während des offenen Kodierens schreiben kann, gibt es praktisch keine Grenzen. Die oben aufgeführten und zunächst sehr einfachen theoretischen Notizen erleichterten im Verlauf der Arbeit die Orientierung der zunächst konfus erscheinenden Datenmasse. Hierdurch können Gedanken für ein weiteres Phänomen offen werden, für neue Kategorien, ihre Eigenschaften, ihre dimensionalen Abstufungen usw.
Der nachfolgende Prozess des axialen Kodierens verläuft ebenfalls unter der Erstellung von Memos, die nun eine weitere Ordnung und eine Zusammenfügen der analysierten Kategorien ermöglichen, so dass schließlich eine Integration sämtlicher Kategorien erreicht werden kann.
7.1.3 Das Paradigmatische Modell im Prozess des axialen Kodierens
Das Vorgehen des axialen Kodierens wurde bereits in Kapitel VI kurz erwähnt (6.7.2). Zielsetzung des axialen Kodierens ist es, „hypothetische Beziehungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien gemäß dem Paradigma anzunehmen und zu verifizieren“ (Strauss/ Corbin 1996, 182). Weiterhin werden bei diesem Vorgang die Eigenschaften von Phänomenen auf ihre Variationen untersucht (den jeweiligen Dimensionen).
Im anschließenden Verlauf des axialen Kodierens wird die Kategorie „Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln mit weiteren wesentlichen und kennzeichnenden Kategorien auf neue Art zusammengesetzt und verbunden. Am Ende soll eine Interpretation der Daten erzielt werden, die über das bisherige Klassifizieren hinausgeht. Erreicht wird dies, indem Bedingungen des Phänomens herausgestellt, der Handlungskontext des Handelns der Individuen ermittelt sowie intervenierende Bedingungen und daraus folgende Handlungen und Konsequenzen herausgearbeitet werden. Diese Arbeit mit den Daten kann zur Erkenntnis führen, dass ein Vorfall, der ursprünglich als Kategorie bezeichnete wurde, sich als Bedingung, Konsequenz usw. eines abstrakteren Phänomens erweist. So hat es sich schließlich auch mit dem hier vorgestellten Phänomen der Hilflosigkeit ereignet, das sich im weiteren Analyseprozess als eine von mehreren ursächlichen Bedingungen für die umfassende Kernkategorie einordnen ließ.
Der hier vorgestellte Untersuchungsabschnitt lässt sich in ein paradigmatisches Modell einordnen, das vereinfacht dargestellt so aussieht(9):
Abb. VII. 2 Kodierparadigma für sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Stil der Grounded Theory
Die weitere Bearbeitung und Analyse des Datenmaterials innerhalb des axialen Kodierens dient der Verknüpfung der entwickelten Subkategorien mit einer übergeordneten Kategorie. Hierzu wird ein Satz von Relationen aufgestellt (s. o.), der sich auf ein herausragendes Phänomen und dessen ursächliche Bedingungen, den Kontext sowie intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien und schließlich Konsequenzen bezieht (10). Mit dieser Vorgehensweise werden die im offenen Kodieren aufgebrochenen Daten auf eine neue Art wieder zusammengefügt und dadurch eine von möglicherweise mehreren verschiedenen Hauptkategorien entwickelt.
Die Zielsetzung dieses Arbeitsschrittes besteht darin, hypothetische Beziehungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien gemäß dem Paradigma anzunehmen und zu verifizieren sowie nach Variationen in den Eigenschaften der Kategorien zu suchen.
Um die (zunächst) hypothetischen Beziehungen der Subkategorien und der dazugehörigen Hauptkategorie zu entwickeln und schließlich zu einer Verifizierung zu gelangen, ist es notwendig und hilfreich, theoretische Notizen in Form von Diagrammen (7.1.3) anzufertigen. Diese dienen als Erweiterung der im Prozess des offenen Kodierens erstellten Memos durch das Verknüpfen und Entwickeln von Kategorien mit Hilfe eines paradigmatischen Modells. So können interkategorialen Beziehungen leicht herausgefunden und eine Systematik bezüglich der komplexen Beziehungsstruktur zwischen den Daten erreicht werden. Dies sichert eine Theorie, die sich durch Dichte und Präzision auszeichnet.
Das axiale Kodieren gestaltet sich sehr komplex, da die analytischen Schritte durchweg simultan ablaufen. Im Wesentlichen ist man mit vier verschiedenen „Aufgaben“ beschäftigt, die den grundlegenden analytischen Verfahren „Stellen von Fragen“ und „Ziehen von Vergleichen“ (11) untergeordnet sind:
1) Subkategorien werden zu einer Kategorie hypothetisch in Beziehung gesetzt. Die Beziehungen zwischen Subkategorie und Phänomen können aus dem zuvor durchgeführten theoretischen Kodieren entwickelt werden.
2) Hypothesen werden anhand der vorliegenden Daten verifiziert, d. h. man arbeitet in einem zirkulären Prozess und kehrt dadurch immer wieder zu den Daten zurück, sucht dort nach Hinweisen und Ereignissen, die die gestellten Fragen bestätigen oder widerlegen.
3) Es werden weitere Eigenschaften und deren dimensionalen Einordnung der entwickelten Kategorien und Subkategorien ermittelt.
4) Es wird nach Variationen von Phänomenen gesucht durch den Vergleich von Kategorien und Subkategorien, die verschiedene Muster aufweisen. Solche Hinweise auf Unterschiede innerhalb der Untersuchung sind ein wichtiger Bestandteil, um die später entwickelte Theorie zu festigen (12).
Das schriftliche Festhalten eines paradigmatischen Modells kann in einem ersten Schritt sehr übersichtlich schematisch dargestellt werden. So lassen sich die jeweiligen Analyseergebnisse vorerst durch einen Satz von Beziehungen systematisch abbilden. Dies soll nun für den oben dargestellten Interviewausschnitt exemplifiziert werden.
7.1.4 Der Einsatz von Diagrammen
Neben den unterschiedlichen theoretischen Notizen, die bereits im Verlauf des offenen Kodierens entstehen, werden auch während des axialen Kodierens weiterhin Memos über das untersuchte Phänomen verfasst. Dieser Prozess verläuft jedoch spezifischer, indem eingehende Fragen an das Phänomen gestellt werden.
Die zuvor angefertigte erste Notiz zu dem Phänomen Hilflosigkeit im erzieherischen Handeln wird hierbei nicht dargestellt. Bei dieser Art des frühen Dokumentierens wird der Interviewausschnitt auf die oben genannten Bedingungen und Konsequenzen befragt, die zum Auftauchen des Phänomens führen und dies (ähnlich wie beim offenen Kodieren) in theoretischer Notizform festgehalten.
In einem Diagramm lassen sich die Analyseresultate nun zusammenfassend sehr übersichtlich abbilden:
Abb. VII.3 Paradigmatisches Modell zum Phänomen „Hilflosigkeit“ im elterlichen Erziehungsverhalten
Die oben als geordneter Ablauf dargestellte Sequenz von Phänomen, ihrer ursächlichen, kontextualen und intervenierenden Bedingungen und deren Konsequenzen ist so selbstverständlich in der sozialen Realität nicht anzutreffen. Es handelt sich stets um Prozesse, wobei die Konsequenzen von Handlungen immer auch von den Bedingungen eingeholt werden. So können Veränderungen von Bedingungen zu einer entsprechenden Reaktion führen, was wiederum zur Änderung der Konsequenz führt.
Des Weiteren kann die Einordnung eines Phänomens als Bedingung, Konsequenz o. ä. als unrichtig erkannt werden, wie in oben aufgeführtem Beispiel: Im weiteren Verlauf der Untersuchung (siehe das Verfahren des selektiven Kodierens im Anschluss im Abschnitt 7.3) wurde die Kategorie „Hilflosigkeit“ durch das systematische In-Beziehung-Setzen mit der Kernkategorie als Bedingung angesehen, die unter den weiter gefassten Begriff der „Angst“ im Umgang mit schulischen Alltag subsumiert werden kann. Die „Hilflosigkeit“ der Eltern im Umgang mit dem Schulalltag führt dazu, dass Handlungsstrategien entwickelt werden, die diese Hilflosigkeit zumindest vorübergehend zu kompensieren versuchen.
Nachfolgend soll nun eine erste Darstellung der Auswertungsergebnisse von Elterninterviews gegeben werden. Hierzu wird auf weitere wesentliche Kategorien eingegangen, die als zentrale analytische Konzepte angesehen werden können, der Erschließung der Theorie dienen und die dem eigentlichen Untersuchungsphänomen der familiären Inklusion der schulbezogenen Kommunikation aus der Perspektive der Eltern Konturen verleihen sollen.
Die vorgestellten Kategorien sind im Verlauf der Analyse in Bezug auf ihre Subkategorien entstanden, so dass es sich bei der Darstellung –wie dies für die gesamte Präsentation der einzelnen Arbeitsschritte gilt– um ein Resultat eines umfangreichen Arbeitsprozesses handelt.
7.2 Zentrale Aspekte um die Auseinandersetzung mit dem Schulalltag in der Familie aus Sicht von Eltern und SchülerInnen
Individuen und Gruppen –in dieser Arbeit Eltern und SchülerInnen, die gemeinsam als Familie auftreten– interagieren und handeln immer im Zusammenhang bestimmter Ereignisse und Situationen. Die Handlung umfasst den zweckgerichteten und zielorientierten Umgang mit einem Ereignis bzw. Phänomen, seine Bewältigung oder die Reaktion hierauf, wobei das Phänomen unter spezifischen Bedingungen auftritt und einen bestimmten Kontext um sich herum vereint. Die interaktionale Komponente bezieht sich dabei auf das Selbst des Handelnden und auf weitere Interaktionen. Handlung und Interaktion orientieren sich an unterschiedlichen Bedingungen und rufen unterschiedliche Konsequenzen hervor, wodurch sie in einem prozesshaften Verlauf auftreten: Ändern sich die kausalen, kontextualen oder intervenierenden Bedingungen eines Phänomens (7.1.3), so ändern sich auch Handlung und Interaktion mit dem Ergebnis einer neuen Konsequenz.
Um beim oben genannten Beispiel zu bleiben, könnte eine der intervenierenden Bedingungen dadurch zumindest gemildert werden, indem ein neuer Lebenspartner der allein erziehenden Mutter einen Teil ihrer Hilflosigkeit auffängt. Diese Veränderung könnte zur Konsequenz eine erleichternde Erziehungssituation der Mutter bedeuten, wodurch sie ihre Hilflosigkeit durch die Hilfe des neuen Partners reduzieren kann. Andererseits kann hierdurch eine neue kontextuale Bedingung entstehen, die dann wiederum den handelnden Umgang mit dem Phänomen verändern kann. Somit erfolgt die Handlung bzw. Interaktion immer in Beziehung zu ihren Bedingungen und Konsequenzen und wird auf einen solchen prozessualen Verlauf auch untersucht.
An dieser Stelle der Datenanalyse, dem axialen Kodieren, können solche Muster von dimensionalen Ausprägungen in den Ereignissen und Vorfällen, die zu einem bestimmten Phänomen gehören, festgestellt werden. Es lassen sich bereits jetzt zweckgerichtete und untereinander verbundene Handlungs- und Interaktionsabfolgen bezüglich der verschiedenen Phänomene herausarbeiten, die eine (vorläufige) Erklärung elterlichen Handelns im Umgang mit dem Schulalltag liefern.
So konnten innerhalb der Elterninterviews Unterschiede im Umgang mit der Verarbeitung des Schulalltags in der Familie festgestellt werden, die sich je nach Stärke der Belastung durch die Schule, durch die Anzahl weiterer Schulkinder in der Familie usw. ergaben. Es konnten Differenzen in den Ursachen für sowie in der Art des Umgangs und der Kompensation dieser Belastung festgestellt werden. Eigenschaften von Bedingungen, Strategien und Konsequenzen, die sich auf ein Phänomen beziehen, zeigen während der Arbeit mit den Daten interagierende Zusammenhänge von Ereignissen. So wurde bei den Aussagen der Elternteile deutlich, dass die Belastung durch den schulischen Alltag in sehr unterschiedlicher Weise zum Vorschein kommt und Konsequenzen, die den Beteiligten als solche gar nicht bewusst sind, frühzeitig oder bereits seit einigen Jahren erfolgen, wodurch diese Konsequenzen dann wieder zur Bedingung für den weiteren Umgang mit der Situation werden können usw.
Der nachfolgende Überblick der Analyseergebnisse, der zentrale Themen beinhaltet, die auf eine von Seiten der Eltern erlebte Trennung der Lebenswelten von Familie und Schule hindeuten, orientiert sich sprachlich und inhaltlich sehr eng am Datenmaterial und soll den Leser bzw. die Leserin sukzessive an die Ergebnisse des Untersuchungsfeldes Elternhaus heranführen, um die hohe Komplexität der hier vorherrschenden sozialen Zusammenhänge zu verstehen. Die analytischen Konzepte, die hierbei entwickelt werden, lassen eine erste Gestalt des Hauptuntersuchungsphänomens der Frage einer Teilhabe familiärer an schulbezogener Kommunikation aus der Perspektive von Eltern und SchülerInnen als Beobachter zustande kommen. Die hier angeführten Themen umfassen insgesamt solche, die innerhalb des Theoretical Samplings von den ausgewählten Fällen der Elterninterviews und Aufsätzen der SchülerInnen entstanden und jeweils kodiert und interpretiert wurden. Diese aus dem offenen Kodieren gewonnen Indikatoren können nun auf die Themenbereiche global strukturierend dargestellt werden und – nachdem sie auf ihre Handlungsstrategien und interaktionalen Zusammenhänge untersucht wurden – als vorläufige Analyse in den weiteren Prozess einfließen. Um eine Unterstützung der Indikatoren zu erreichen, können bereits vorhandene Forschungsberichte, veröffentliche Artikel o. ä. zu einem ähnlichen Untersuchungsbereich auf die selbst analysierten Phänomene bezogen werden. Dabei ist jedoch die Vorsicht geboten, sich nicht vorbehaltlos auf die Interpretationen solcher Forschungsergebnisse zu stützen. Die Analyse muss letztlich immer am eigenen Datenmaterial verifiziert werden können.
Der nachfolgenden Interpretation, die an dieser Stelle bereits einen strukturierenden Charakter aufweist, fehlt es selbstverständlich noch an umfassender Tiefe, die im später ansetzenden Prozess des selektiven Kodierens gelingt.
7.2.1 Sorgen und Ängste, die durch die „Andere Welt“ bei Eltern hervorgerufen werden
Der erste zentrale Aspekt, der ersichtlich wird, wenn Eltern über den Schulalltag sprechen, entspricht im weitesten Sinne Ängsten, die in ihrer Art und Ausprägung sehr unterschiedlich sind, sich aber überwiegend in der Einschätzung der Folgen schulischer Anforderungen und schulisch-organisatorischer Gegebenheiten widerspiegeln. Damit umfasst der gewählte Ausdruck Sorgen eine Reihe von Aussagen, die sich auf die authentische Wahrnehmung des schulischen Alltags aus der Sicht der Eltern beziehen, z. B. die Anforderungen, die gerade kurz vor Erreichen des ersten Sekundarabschlusses erfüllt sein müssen, um Jugendlichen eine weitere Perspektive zu bieten, weiterhin die Tatsache, dass Schule in ihrer Selektionsfunktion zur Ungleichheit von Bildungschancen führt und schließlich die zunehmende Distanzierung der Jugendlichen von der bis dahin zentralen Erziehungsinstanz Elternhaus, welche nun zunehmend abgelöst oder sogar ersetzt wird durch außerfamiliäre Systeme.
Diese Aussagen beschreiben grundlegend die offensichtliche Erkenntnis der Eltern hinsichtlich einer Trennung von Elternhaus und Schule, die jedoch nicht als völlige Abspaltung des einen von dem anderen System angesehen werden kann, sondern trotz oder gerade wegen der Differenzen auf eine gegenseitige Einflussnahme (zunächst die der Schule auf das Elternhaus) hinweist.
Die Frage, wie Sorgen und Ängste in der Familie durch die tägliche Konfrontation mit dem Schulleben entstehen, soll nun einer Mehrebenenanalyse unterzogen werden, um den Verlauf dieses Ereignisses auf Grund seiner weitreichenden Bedingungsfaktoren zu verfolgen. Bedingungen ergeben sich dabei nicht nur im unmittelbaren Umfeld, also der Familie oder der Schule, sondern zeigen eine weitreichende Genese, die von politischen, gesellschaftlichen sowie organisatorischen Umständen abhängt und ihre eigentliche Auswirkung schließlich in der zuvor beschriebenen Handlungs- und Interaktionsfolge des einzelnen Individuums oder einer Gruppe zeigt.
Die Analyse beginnt mit der Betrachtung der gesellschaftlichen Makroebene, die im Sinne einer hochmodernen Leistungsgesellschaft die Vorgaben macht, die schließlich auch schulpolitische Debatten in Gang setzt. Wie bereits im einführenden Kapitel dieser Arbeit dargestellt, sind es international ausgerichtete Leistungsvergleiche von SchülerInnen, die auf nationaler Ebene zur Umstrukturierung von Lehr- und Lernmethoden führen und eine Verschärfung des schulisch ausgerichteten Leistungsgedankens herbeiführen. Am Ende dieses konkurrierenden Leistungsstrebens steht unter dem Einfluss der globalen Ökonomie die wesentliche Frage der sozialen Platzierung, die in Deutschland wie in anderen modernen Gesellschaften letztendlich durch den entsprechenden Beruf bzw. Arbeitsplatz definiert wird. Dieser Einfluss erscheint zunächst als weit entfernt von dem familiär entstehenden Phänomen der Angst, bietet für diese aber eine wesentliche Determinante für den Umgang mit dem Schulleben innerhalb der Familie.
Die internationalen „Vorgaben“ führen auf schulisch-organisatorischer Ebene zum Versuch der Verwirklichung optimaler Lehr- und Lernstrategien, um dem gesellschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. So gibt es seit einigen Jahren von Schulen durchgeführte Programme, die zu einer Qualitätsverbesserung und Qualitätssteigerung führen sollen und nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse von PISA spezifisch auf die dort dargestellten Defizite ausgerichtet sind. Wenn sich die Einzelschule mit solchen Qualitätsprogrammen (13) zum Erreichen von international angemessenen Standards befasst, so handelt es sich hierbei um eine Schulentwicklung, die darauf abzielt, zumindest theoretisch den Schulerfolg von SchülerInnen zu verbessern und erzieherische Wirkungen der Schule zu stärken. Da der Qualitätsbegriff (14) für Schulen in Deutschland noch überwiegend durch gute Leistungen einer möglichst hohen SchülerInnenzahl definiert wird und somit sehr einschränkend auf einen ganzheitlichen Bildungsbegriff wirkt, gehen Inhalte wie soziales Lernen, Kreativität, Originalität, Zusammenhängendes Lernen usw. ebenso verloren wie die individuelle Hilfe auch für leistungsschwächere SchülerInnen, die in anderen Ländern, z. B. im anglo-amerikanischen Raum als selbstverständlich für gute Schulqualität gelten.
Eltern stellen bezüglich ihrer Vorstellung von Schulqualität fest: „Unterrichtsausfall[…]die einzigen, die darunter leiden müssen, sind natürlich die Schüler“, ein schulorganisatorisches Defizit, das auf Grund der politischen Debatten für die der Schule übergeordneten Instanzen (Ministerien, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) bzw. die Schule selbst einen Sekundärcharakter erhält. Dieser Mangel an Qualität aus Sicht der Eltern wird deswegen als beängstigend empfunden, da sie hierin die Gefahr einer Benachteiligung und Überforderung ihrer Kinder sehen, „die jetzt ein Voll-Power-Programm bekommen,[…], damit sie zumindest das Schulziel erreichen.“ Und weil Eltern ihre Funktion innerhalb des Schulalltags klar in eine eher ohnmächtige Position einordnen, wie das folgende Beispiel zeigt:
„Alles, was in der Schule läuft, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, das heißt also, wenn die Kinder morgens in die Schule kommen und sitzen vor einem Lehrer, dann hat über die nächsten fünf Schulstunden oder sechs Schulstunden zumindest mal der Lehrer die Amtshoheit, würde ich mal sagen, das heißt, wenn die Kinder dort tun und machen können, was sie wollen, und auch keine oder wenig Grenzen gezeigt bekommen, dann sind natürlich die Einflussmöglichkeiten der Eltern sehr begrenzt“,
entsteht das unbefriedigende Gefühl eines vom Schulleben ausgeschlossenen Familienlebens durch den von außen organisierten Schulalltag.
Konkretisiert werden Sorgen, die der schulische Alltag mit sich bringt, durch das Gefühl, allein mit den An- und Überforderungen zu sein. Das Phänomen „allein“ hat sich innerhalb der Elterninterviews vielfältig dargestellt. So empfinden Eltern, die durch die Übernahme einer partizipierenden und organisierenden Funktion (z. B. als ElternsprecherIn) den Kontakt zu anderen Eltern gesucht haben, das Gefühl des Alleinseins als Enttäuschung, wenn andere Eltern weniger engagiert sind – „Da war also das Interesse nicht mehr so groß und[…]dann verliert man ja irgendwie dann auch die Lust“ – und mehr das Gelingen des Schulverlaufes ihres eigenen Kindes in den Vordergrund stellen – „Das sind so Eltern. Jeder ist nur noch mit sich selbst beschäftigt und das finde ich so schlimm[…]es kümmert sich keiner mehr um den anderen“.
Alleinerziehende vermissen innerhalb der Familie einen Partner, mit dem sie den Ängsten im Umgang mit der Schule gemeinsam begegnen können: „und dadurch, dass ich alleine bin, bin ich ganz schön gefrustet stellenweise, weil ich immer alleine diesen Kampf Tag für Tag, Abend für Abend ausführen muss“.
Ganz deutlich wird in der Familie der Umgang reflektiert, den LehrerInnen als Erziehungsberechtigte mit den eigenen Kindern pflegen. Was zu Hause selbstverständlich in die Betreuung des eigenen Kindes einfließt, wird in der Schule vermisst – „Ach du lieber Himmel, was wird denn das, ja was macht dann der P., so ein Typ wie unser P., wenn da ja keiner tut oder guckt?“, und lässt Bedenken bezüglich einer ausreichenden „Versorgung“ des Kindes in der Institution Schule aufkommen. So entsteht ein Gefühl von „hier“ und „dort“, wobei die Familie das „Hier“ ist, wo die Betreuung des eigenen Kindes individuell orientiert verläuft – „Wenn man mit dem ein bisschen was macht, schreibt der sofort drei Noten besser“ – während die Schule als „Dort“ angesehen wird, wo der Einzelne seiner besonderen Ansprüche entbehren muss und durch die Familie dieses Defizit ausgeglichen werden muss: „[…]ja was macht dann der P., so ein Typ wie unser P., wenn da ja keiner tut oder guckt, dann muss ich das wohl machen“.
Eine weitere Distanzierung von der Welt der Schule zeigt sich in Bedenken, dem schulischen Prestige nicht entsprechen zu können. Obwohl die Leistungen und die Bereitschaft von Jugendlichen selbst vielleicht gegeben sind, übernehmen Eltern letztendlich die Zuordnung zu familienangemessenen Verhältnissen, weil sie sich dort eher zugehörig fühlen: „Wir waren halt nicht von der gehobenen Klasse“. Eltern nehmen dadurch selbst eine soziale Einordnung vor, die dann je nach Entsprechen oder Nicht-Entsprechen Auswirkungen auf die Wahl der weiterführenden Schule hat. Auch die Vorerfahrung von anderen Kindern der Familie trägt entscheidend dazu bei, welche Schulart gewählt wird. – „Die Große aus der Ehe vor der S. hatte damals auch den Wunsch auf das Gymnasium zu gehen, hat das dann zwei Jahre gemacht und war aber von den Leistungen her so zurückgefallen, dass wir sie dann runterholen mussten[…]und da habe ich gesagt, das gibt nichts mit der S., sie soll Realschule machen und wenn sie dann halt den Wunsch hat, dass sie weitermachen will, dann kann sie den Abschluss über das Abitur nach der Realschule immer noch machen“. Es scheint, als empfänden Eltern dadurch eine weniger beängstigende und für sie selbst sicherere Situation im Umgang mit Schule.
Die grundsätzliche Frage, warum Eltern den Schulalltag, der zu Hause an sie herangetragen wird, mit einem eher besorgten Gefühl verbinden, lässt sich nach dieser Analyse überwiegend auf den Aspekt der Auswirkungen und des Einflusses der Schule auf das Leben des eigenen Kindes erklären. Vorrangig handelt es sich dabei um das, was die Schule verlangt, um ein entsprechendes Zertifikat für die weitere soziale Platzierung in der Gesellschaft zu erhalten. Die Bedenken der Eltern weisen auf eine komplizierte Gestalt hinsichtlich ihrer Entstehung hin, da die Erwartungen an die Jugendlichen nicht allein in der Schule entstehen, sondern ebenso im Elternhaus geprägt werden: „Also, dass die einen ordentlichen Schulabschluss haben, das will man ja, das ist ja klar. Dass zumindest der Realschulabschluss mal da ist“. Die gesellschaftlichen Bedingungen, die letztlich beide Institutionen zum Leistungsstreben führen, wurden ja bereits erläutert.
Die elterlichen Ängste in der Begegnung mit dem Schulalltag spiegeln sicherlich auch eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit dieser „anderen Welt“ wider. So wie die Gruppe der Gleichaltrigen, mit denen Jugendliche Umgang haben, von der Familie auf standesgemäßen Umgang (15) „geprüft“ wird, so konstruieren Eltern auch ein Bild von Schule, das hinsichtlich des Sozialprestiges möglichst dem der Familie entsprechen muss. Eltern fühlen sich offensichtlich dort sicherer, wo familienähnliche Verhältnisse zu erwarten sind und wo Differenzen zum eigenen sozialen Stand auszuscheiden scheinen.
Die initiierte Distanz von Elternhaus und Schule, die sich hier auftut, weist auf sehr ambivalente Ursachen hin. So verlangen Eltern einerseits nach der erzieherischen Unterstützung durch die Schule, um die geforderten gesellschaftlichen Erwartungen und Voraussetzungen zu erreichen, zweifeln an der ausreichenden Übernahme dieser schulischen Aufgabe – „Aber die Schule grundsätzlich hat für uns einen edukativen Charakter, ganz klar, der in meinen Augen viel zu wenig wahrgenommen wird[…]wo wir zu Hause das fortführen dürfen – müssen – sollen, was die Schule eben nicht macht“ – wollen aber andererseits keine großen Differenzen von schulischen Strukturen in ihre familienorientiertes Handeln aufnehmen, da dies befremdend und damit ebenso beängstigend wirkt. Wenn die Schule nicht im Sinne der Eltern handelt, so sind sie „enttäuscht“.
Die ambivalente Voraussetzung für das Entstehen von Angst im täglichen Umgang mit dem Schulalltag, die sich einmal durch die Eigenerwartung der Eltern hinsichtlich schulischen Handelns ergibt und auf dieser Ebene Defizite aufzuweisen scheint, zum anderen durch die Fremderwartung der Schule an Eltern und Jugendliche schafft die Basis einer kritischen Betrachtung von Schule seitens der Eltern stellt sich jedoch nicht im Sinne einer generell ablehnenden Haltung der Eltern gegenüber der Schule dar, sondern zeugt ebenso von einem verantwortungsbewussten (siehe hierzu ausführlich 7.2.2) Umgang mit dieser Lebenssituation. Ein vorsichtiger Umgang mit Gegebenheiten bedeutet zudem ja auch immer, dass etwas genau beobachtet und bewertet wird.
Ungeachtet dessen bleibt das Dilemma bestehen, dass Eltern eine Weltendifferenzierung in ihrem Familienleben besonders in der Zeit erleben, in der sich ihre jugendlichen Kinder mit den außerfamiliären Welten befassen.
Die einseitige Betrachtung der „Sorge“ von Eltern im Umgang mit dem Schulalltag, die eine abgrenzende Haltung gegenüber der Schule aufzeigt, kann aber auch eine umfassendere Bedeutung erhalten, wenn man einräumt, dass die kritische Betrachtung einer außerfamilialen Instanz, die unbestritten einen wesentlichen Einfluss auf Jugendliche und deren weiteren Lebensweg hat, nicht mehr als gerechtfertigt ist und als Kontrollinstrument schulischen Alltags gelten kann, der ansonsten ausschließlich seinen eigenen institutionellen Bedingungen verlaufen würde.
So lässt sich an dieser Stelle die Hypothese aufstellen, dass in der Familie der Schulalltag mit Sorge betrachtet wird, wenn Eltern bewusst wird, dass Schule Auswirkungen auf den weiteren Lebensverlauf ihrer Kinder hat und dadurch eine Unsicherheit in der innerfamiliären Handlung entsteht. Die Sorgen und Ängste von Eltern verstärken sich dann, wenn äußere Bedingungen, z. B. die Organisation des Unterrichtsablaufes in einer nicht ordnungsgemäßen Form verlaufen und der Familie direkt bewusst werden – „Das war also täglich, fast täglich, dass er dann früher heim kam, also wenigstens mal eine Stunde“ oder wenn Eltern das Gefühl haben, sie seien schulischen Einflüssen ohnmächtig ausgeliefert.
Diese Reflexionen sind zurückzuführen auf die Auseinandersetzung mit den Erwartungen aus der Umwelt, wobei die Familie schulische Handlungen auf eine seitens der Familie kritisch-hilflose Situation hin, die dazu führt, dass Sorgen und Ängste entstehen, die Eltern und ihre Kinder unter einen gewissen (Leistungs-)Druck setzen, damit die zuvor erwähnten gesellschaftlichen und schulischen Rahmenbedingungen erfüllt werden. Innerhalb der Familie führt dies zu einer übersteigerten Erwartung und Kontrolle, die bei Jugendlichen das Gefühl von Druck und Zwang auslöst: „Die meisten Eltern fragen so viel nach, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder machen, denn wenn man in der Schule schlecht ist, einmal sitzen bleibt oder sogar die Schule wechseln muss, wie es dann später einmal weitergehen soll, welche Arbeit man bekommt. Bei mir war das auch so, dass meine Mutter mich unter Druck gesetzt hat und immer wieder nachgefragt hat. Ich hatte deswegen keine Lust mehr zu lernen. Und ich wurde immer schlechter in der Schule. Das hatte dann die Folge, dass meine Mutter sich noch mehr Sorgen gemacht hat und immer mehr und öfter gefragt hat[…]das ging mir alles total auf die Nerven“ und bei Eltern kontinuierlich die Frage des notwendigen und möglichen Einflusses auf die schulische Situation aufwirft.
Abb. VII.4 Bedingungen, die auf das Phänomen „Sorgen und Ängste im Umgang mit dem schulischen Alltag“ einwirken
Die Ambiguität im Handeln der Eltern, die hierdurch vorprogrammiert ist – „Man muss da immer ein bisschen nachhaken“ einerseits, und „Ich erwarte eigentlich von ihm, dass er selbstständig ist[…]da erwarte ich eigentlich schon selbstständiges Schaffen“, bezieht sich zunächst auf die Frage von Verantwortungsübernahme von Eltern versus Verantwortungsübertragung der Eltern auf ihre Kinder als SchülerInnen, während sich eine weitere Übertragung der Verantwortung auf Schule und LehrerInnen gerichtet ist „Also das finde ich bei weiterführenden Klassen also bei den höheren finde ich das sehr wichtig, dass die Lehrer ihnen zeigen, wo’s lang geht“.
Das Phänomen der Verantwortung, das nachfolgend einer näheren Betrachtung unterzogen wird, nimmt eine beachtlich große reflexive Kapazität im gesamten Verlauf des Schullebens sowohl bei Eltern als auch deren Kindern in Anspruch. So gibt es weder ein Elterninterview noch einen Aufsatz der SchülerInnen, die diesen Thema nicht ansprechen. In der Mehrzahl der analysierten Fälle kann sogar davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um das zentrale Thema handelt.
Das thematische Ergebnis, das sich an dieser Stelle hervorhebt, ist die auch im Einzelfall dauernd wechselnde Position bei der Frage, wie viel Verantwortung nötig ist und wer von den Beteiligten sie übernehmen soll. Eltern geraten hierdurch, anders als im Familienleben, wo die Frage der Erziehung zur Selbstständigkeit komplikationslos erscheint – „Ich habe meine Kinder von klein an erzogen, für ihren Kram verantwortlich zu sein“ – in einen „Gewissenskonflikt“.
7.2.2 Der Umgang mit Verantwortung
Wie zuvor bereits erwähnt, steht die Frage der Verantwortung im Mittelpunkt der schulischen Belange, die in das Familienleben eingreifen. Bei der Betrachtung der verschiedenen „Verantwortungstypen“, die sich aus den Elterninterviews herauskristallisieren lassen, kann nun die folgende einleitende Hypothese aufgestellt werden: Um den Umgang mit dem Schulleben innerhalb der Familie möglichst erfolgreich (16) zu bewältigen, werden von Eltern unterschiedliche Strategien angewendet, die sich in jedem Einzelfall an schulischen Vorerfahrungen (eigene oder solche durch weitere Schulkinder in der Familie), aktuellem Schulverlauf (bezüglich Leistungen, LehrerInnen, MitschülerInnen usw.) und der Handhabung mit Verantwortung im außerschulischen Familienleben orientieren.
Dabei fällt auf, dass es bei Eltern drei wesentliche Typisierungen im Umgang mit dem Verantwortungshandeln gibt, die weiter nachfolgend aufgeführt sind und wiederum mit dem empirischen Datenmaterial belegt werden.
Bei der Frage der Verantwortung gerät vornehmlich der Aspekt der schulischen Leistungen in den Vordergrund, in Ausnahmen auch das Verhältnis des eigenen Kindes zu LehrerInnen. Mit der Differenzierung „bei uns in der Familie“ und „schulisch gesehen“ weisen Eltern deutlich auf die unterschiedliche Handhabung im erzieherischen Umgang der Verantwortung hin. Was sich im „modernen Erziehungshaushalt“ (17) nicht mehr als Frage stellt, wird in den letzten Jahren der Schullaufbahn für den Bereich der Bewältigung des schulischen Alltags zum Erziehungsthema, wobei das „richtige Maß“ der Verantwortung, die Eltern für das Schulleben ihrer zur Selbstständigkeit erzogenen Kinder hinterfragen. Beantwortet wird diese Frage vor dem Hintergrund verschiedener Möglichkeiten, wobei die Bezeichnung „Verantwortung“ eine Reihe von Eigenschaften umfasst, die im Rahmen der Feinanalyse dieses Phänomens als unterschiedliche Strategien im Umgang mit Verantwortung herausgearbeitet werden konnten:
• Die produktive Strategie:
Der produktive Umgang mit Verantwortung für das Schulleben seitens der Eltern entspricht dem Bild einer Erziehung zur Selbstständigkeit und Autonomie von Jugendlichen, ohne jedoch das Interesse für schulisches Geschehen aus den Augen zu verlieren und eine gewisse Leistungserwartung zu unterminieren. Es ist zu vermuten, dass diese Art des Umgangs mit Verantwortung vor allem von solchen Eltern ausgeübt werden kann, die eine rigidere Form auf Grund von mindestens zufriedenstellenden Schulleistungen und einer geringen Ausprägung an offensichtlichem Konfliktpotential hinsichtlich schulischer Belange nicht in Anspruch nehmen müssen (18). Erfolgt der Umgang mit Verantwortung in einem produktiven Rahmen, so lassen sich im Elternhaus insgesamt liberale Erziehungspraktiken feststellen, die auch auf das Handeln in Auseinadersetzung mit dem Schulalltag übertragen werden.
Zusätzlich zu diesem Phänomen des liberalen Verantwortungshandelns kommt auch die elterliche Einsicht der Ablösungsphase von Jugendlichen von der Familie. Heranwachsende erkennen ihre persönlichen Ziele und die Wege zum Erreichen solcher Ziele, die Schule wird nicht mehr nur betrachtet als „tägliche Aufgabe“, sondern im Zusammenhang mit der bevorstehenden Statuspassage „da legt sich wie so ein Schalter um, und dann wissen die auch warum und was sie wollen und so. Das geht einfach ganz schnell“.
Produktiver Umgang mit Verantwortung bedeutet weiterhin, dass die Verantwortung für schulisches Handeln, die weitgehend den Jugendlichen selbst unterliegt, dann aber von den Eltern unterstützend mitübernommen wird, wenn dies für notwendig gehalten wird:
„Man kann ja auch mal in die Schule kommen und gesagt kriegen, dass alles in Ordnung ist, und wir haben gar keine Probleme, das ist auch ganz angenehm, dadurch habe ich auch ehrlich gesagt keine großartigen Sachen mit der Schule, halte mich eigentlich in vielem sehr zurück, vieles macht dann die A. ganz alleine[…]und wenn’s dann gar nicht hin und her klappt, dann setzen wir uns abends oder bzw. dann morgens[…]dann reden wir noch kurz darüber“.
Durch diese Art des Verantwortungshandelns von Eltern entsteht für Jugendliche die Möglichkeit, auch für den schulischen Alltag ihren individuellen Weg zu finden, der weitgehend frei ist von Druck und Kontrolle, andererseits aber auch einen hohen Grad an Selbstdisziplin von SchülerInnen fordert.
Eine ähnliche Variante, die jedoch eine stärkere „Beaufsichtigung“ des Schulalltags zu Hause erfährt, wird hier als bedarfsorientiert dargestellt. Auch dabei besteht ein relativ elternunabhängiger Umgang mit schulischen Belangen innerhalb des Familienlebens, der aber bei entsprechendem Anlass auch in ein kontrollierendes und eingreifendes Handeln der Eltern münden kann.
• Die bedarfsorientierte Strategie:
Während der produktive Charakter des Rückzugs der Eltern aus der Verantwortung des schulischen Handelns von Jugendlichen sich in den meisten Fällen als solche Konstellation gezeigt hat, die gleicher Zeit auch einen geringen schulthematischen Informationsfluss von Jugendlichen aufweist („Der erzählt auch überhaupt nichts aus der Schule[…]es ist ihm nicht wichtig, das zu erzählen[…]ich wusste nie irgend etwas“), deren Schulleistungen sowie der Umgang mit Schule problemlos verläuft, wird der bedarfsorientierte Umgang mit Verantwortung von solchen Eltern praktiziert, die über die meisten Vorkommnisse der Schule Kenntnis haben und dann helfend und unterstützend eingreifen, wenn Jugendliche den Bedarf anmelden. Dieser Bedarf bezieht sich nicht nur auf Hilfestellungen, die das Verstehen von Unterrichtsinhalten betrifft, sondern ebenso Unterstützung einmal im Sinne direkter Partizipation durch die Aufnahme einer Funktion als ElternsprecherIn o. ä. sowie die aktive Mithilfe bei Schulfesten, Ausflügen etc.:
„Ich bin ja zweiter Elternsprecher, aber ich denke, wenn sie älter werden, dann sollen sie so manche Entscheidungen einfach selber treffen. Ja, wenn jetzt irgendein Grillfest oder so was, wenn sie das wollen, unterstützen tun wir sie auf jeden Fall, wenn irgend etwas gebraucht wird wie letztes Jahr, da haben sie mit der Frau M., da waren sie in – ich weiß nicht, auf jeden Fall sind sie gewandert und haben auch im Zelt dort übernachtet und dann haben wir unseren Hänger zur Verfügung gestellt und dann konnten die Kinder ihr Gepäck da einladen und wir sind dann hingefahren[…]ja, wenn so etwas zu machen ist, helfen wir eigentlich immer gerne[…]obwohl bei den Älteren denk ich so eine gewisse Selbstständigkeit soll da schon kommen und ja ich denke, da kann man als Eltern eigentlich nur noch unterstützen“.
Dieses Beispiel steht stellvertretend für die Divergenz im erzieherischen Handeln der Eltern, das von Eltern unterschiedliche Strategien hinsichtlich einer Verantwortungsübertragung und Verantwortungsübernahme verlangt, da die Erziehung zur Autonomie innerhalb der Familie nicht immer mit den Belangen der anderen Lebenswelt Schule zu vereinbaren ist. Produktives Verantwortungshandeln steht jedoch im Gegensatz zu dem nachfolgend definierten übernehmenden bzw. übertragenden Verantwortungshandeln und kann in der überwiegenden Zahl dem analysierten Datenmaterial der SchülerInnen als das gewünschte elterliche Handeln angesehen werden. An dem Beispiel der Aussage einer Schülerin soll dies verdeutlicht werden:
„Ich finde, Eltern sollten sich nicht zu sehr um die Noten ihrer Kinder kümmern. Natürlich sollten sie sagen, dass sie besser lernen sollten, aber nur, wenn die Noten wirklich schlecht sind. Denn ich denke, dass die Kinder die Verantwortung für ihre Noten tragen. Natürlich sollte das den Eltern nicht ganz egal sein, und sie müssen für Fragen und Problem offen sein, aber sich nicht zu sehr einmischen. Sie sollten das Interesse für ihre Kinder und die Schule zeigen und auch auf Elternsprechtage gehen oder Gespräche mit Lehrern führen. Das finde ich sehr wichtig“.
• Die übernehmende bzw. übertragende Strategie:
Eltern übernehmen dann die Verantwortung im Sinne von kontrollierendem Handeln selbst sehr stark, wenn die Leistungserwartungen an ihr Kind besonders hoch sind, wenn das Bewusstsein über den Zeitpunkt der Statuspassage in den Vordergrund gerät und – in diesem Zusammenhang – die eigene Schulbildung und berufliche Position einen gewissen Stellenwert einnimmt. Die Kontrolle umfasst die Schulleistungen des eigenen Kindes dabei ebenso wie den organisatorischen Schulablauf (Freistunden durch Lehrerausfall, Kompetenz von LehrerInnen usw.). Diese Verantwortungsübernahme führt über den kontrollierenden Rahmen hinaus bis zu entscheidenden Maßnahmen, die gerade im Schulabschnitt der weiterführenden Schule von erheblicher Bedeutung sind (Art der weiterführenden Schule, Fächerkombination usw.). Das nachfolgende Beispiel aus dem Datenmaterial der Elterninterviews stellt hierzu einen lebendigen Beitrag dar. Auf die Frage an den Vater eines Schülers, wie den der Schulalltag innerhalb der Familie begleitet wird, antwortet er:
„Die Hauptaufgabe liegt nicht wesentlich bei mir, sondern wie üblich eigentlich bei meiner Frau, die zu Hause ist und nachmittags die Aufgabenbetreuung macht, Lernziele wieder neu durcharbeitet, Dinge aufarbeitet, Dinge durcharbeitet, die zum Teil noch nicht dran kamen, die zum Teil erwartet werden, dass sie kommen, so dass eigentlich vorgearbeitet wird. Die Aufgaben, die Aufgabenstellungen werden vertieft, weil das einer der Punkte ist, die die Schule heute überhaupt nicht mehr vollzieht, nicht mehr durchführen kann[…] Die Schule selber ist dazu in meinen Augen absolut nicht in der Lage und auch nicht Willens und ich habe den Vorteil wir haben den Vorteil, dass sowohl meine Frau wie auch ich, dass wir beide gut ausgebildet sind, wir sind in der Lage, uns zeitlich mit den Kindern zu beschäftigen und wir sind auch in der Lage, die Aufgabenstellung der Schule umzusetzen[…].Ziel ist eindeutig für uns, und das ist auch so ein Motivationsfaktor unserem Sohn gegenüber, dass er die Weiterbildung machen soll auf jeden Fall nach der Realschule und weil wir ihn aus dem Gymnasium unter ganz bestimmten Aspekten auch rausgenommen hatten“.
Die als solche bezeichnete „Nacharbeit“ und „Vorarbeit“ von fachlichen Unterrichtsinhalten bringt die individuelle Bemühung um einen ordentliche Schulbildung zum Ausdruck und gilt der Aufgabe, die vom Vater als unvollständig durchgeführte beurteilte Arbeit der LehrerInnen zu vervollständigen bzw. vorzubereiten, so dass die Verantwortung seitens der Eltern in Bereichen übernommen wird, die eigentlich von der Schule zu leisten sind.
Auch die weitere schulische Bildung des Sohnes ist festgelegt „dass er die Weiterbildung machen soll“, ohne dass hier zunächst der Wille des Jugendlichen erkennbar ist. Der Vorwurf an die unzureichende fachliche und erzieherische Arbeit von LehrerInnen und der Vergleich der Schulbildung des Sohnes mit der eigenen (akademischen) Bildung – „da erinnere ich mich an meine Uni-Zeit“ – führt zu intensiven Beobachtung und Handlung in der Familie.
Der Rückzug aus der Verantwortung mit der Folge der Übertragung dieser auf Jugendliche und LehrerInnen hat mehrere Ursachen. Ähnlich wie im Falle des produktiven Verantwortungshandelns liegt einer der Gründe in der Tatsache, dass die Schulleistungen einem Leistungsbild, das den Eltern diesen Rückzug gestattet. Dadurch erfolgt jedoch gleichzeitig die Übertragung der Verantwortung auf Jugendliche selbst – „Also, der J., der ist ja der Älteste und im achten Schuljahr und ich erwarte eigentlich von ihm, dass er selbstständig ist, weil wir vier Kinder haben und weil ich nach ihm einfach auch nicht mehr so gucken kann, wie das in der Grundschule war, und da erwarte ich eigentlich auch schon selbstständiges Schaffen“ – und dadurch auch eine Überforderung an diese bedeute kann.
Die Erziehung zur Selbstverantwortung, die ja im III. Teil dieser Arbeit ausführlich behandelt wurde, beherbergt zwar für Jugendliche die maximale Möglichkeit an Freiheit, kann aber unter Umständen zur Belastung werden, wenn die elterliche Zuwendung und Unterstützung unzureichend ist oder gar fehlt. Im dargestellten Beispiel folgt jedoch wenige Sätze später eine Relativierung dieser Verantwortungsübertragung durch die Mutter: „Als Mutter macht man sich ja schon Gedanken und Sorgen, wie es weitergeht“, so dass hier, wie auch in den meisten anderen untersuchten Fällen das Extrem der vollkommenen Verantwortungsübertragung schulischer Belange an Jugendliche nahezu auszuschließen ist.
Auch, wenn die Verantwortung auf die Institution Schule und deren LehrerInnen übertragen wird, um das Familienleben vor einem all zu großen schulischen Einfluss schulischer Angelegenheiten frei zu halten, „Und darum finde ich es halt besonders schwierig, also das finde ich bei weiterführenden Klassen also bei höheren finde ich das sehr wichtig, dass sie da, dass die Lehrer ihnen zeigen wo’s lang geht“, wird gleichzeitig die elterliche Hilfe angeboten: „Also es soll schon Unterstützung für die Kinder da sein“, so dass auch in solchen Fällen eher von Mischtypen gesprochen werden kann.
Verantwortung als Fokus im Umgang mit dem Schulalltag zu Hause stellt sich somit als reaktive Handlung innerhalb der Familie dar, die je nach Möglichkeiten und Gegebenheiten einer unterschiedlichen Ausprägung unterzogen wird, letztlich aber –im Rahmen des analysierten empirischen Datenmaterials– ein Interesse der Eltern am Schulleben der Jugendlichen aufweist. Warum Eltern den einen oder anderen Typus im Umgang mit der Verantwortung praktizieren, hängt von den Einstellungen, Vorerfahrungen und Zielen ab und kann in vielen Fällen auch als ausweichende Möglichkeit für das Zeichen einer Hilflosigkeit im Umgang mit Schule darstellen.
So hat die Untersuchung gezeigt, dass gerade die befragten Mütter der Jugendlichen, die aus meist sehr ländlichen Gebieten stammen, mit der tatsächlichen fachlich-orientierten Unterstützung überfordert sind, da ihre eigene Schulbildung oftmals auf der Basis eines Haupt oder Volksschulabschlusses resultiert. Insgesamt können somit verschiedene Faktoren für den unterschiedlichen Umgang mit Verantwortung ausgemacht werden, die sich in zeitlicher Hinsicht durch die Verantwortung für mehrere Kinder im Haushalt oder Berufstätigkeit äußern, die weitere Perspektive schulischer Bildung ins Auge fassen (Leistungsorientierung) oder auf eine mangelnde Möglichkeit hinweisen, die durch Bildungslücken der Eltern bzw. einem Abweichen der Wissensinhalte von Eltern und der heutigen Bildungsinhalte entstehen.
Insgesamt kann für die vorliegenden analysierten Elterninterviews die Dominanz eines übertragenden Verantwortungshandelns ausgemacht werden, wobei hierunter jedoch auch – wenngleich in geringem Ausmaß – die Variante des produktiven Umgangs mit Verantwortung zählt. Für die überwiegende Anzahl der Fälle lässt sich eine Übertragung der Verantwortung auf die SchülerInnen selber – „wenn du nicht lernst, dann musst du eben da hingehen, so du eben körperlich oder so“, oder die Institution Schule feststellen – „sie dient der Grundausbildung für den weiteren Lebensweg“. Es liegt jedoch für kein Interview ein durchgängiges und homogenes Muster vor, so dass die Frage der Verantwortung als wechselhafte Zuständigkeitsfrage für den gelingenden Ablauf des Schulalltags und der Schullaufbahn angesehen werden muss.
7.2.3 Belastungen, mit denen die Familie konfrontiert wird
Als Belastungen sollen in diesem Zusammenhang zusätzliche Anforderungen und Anstrengungen verstanden werden, die durch den schulischen Alltag über die sonstige Inanspruchnahme von Eltern innerhalb des sozialen Lebensraums Familie hinausgehen und die in der überwiegenden Anzahl der analysierten Fälle in hervortretendem Ausmaß als zentrales Thema im Zusammenhang mit der familiären Bewältigung des Schulalltags genannt wurden. Dabei handelt es sich meist um als länger andauernd geschilderte Situationen, die durch den schulisch-organisatorischen Ablauf oder schulische Leistungsanforderungen hervorgerufen werden und deren Ende erst mit dem Ende der Schullaufbahn abzusehen sind.
Im Gegensatz zur Grundschulzeit werden Begebenheiten, die mit der weiterführenden Schule zusammenhängen selten in ihrer organisatorischen Dimension (Besorgung von Materialien für den Unterricht (19), Begleitung zur Schule oder zum Bus etc.), sondern überwiegend in ihrer Beanspruchung, die im Bereich von beunruhigenden Gedanken und Verantwortung für einen gelingenden Schulverlauf liegen, thematisiert. Das bedeutet, dass der zuvor beschriebene Bereich der Verantwortung unmittelbar mit dem Belastungsfaktor zusammenhängt, in dem Sinne, dass Verantwortung für die Bewältigung des Schulalltags bei Eltern eine Situation der Belastung hervorruft.
Belastungen können insofern als an Eltern von jugendlichen SchülerInnen herangetragene Herausforderungen eines schulischen Gelingens dieses Lebensabschnittes definiert werden (20). Unabhängig von dem tatsächlich realisierbaren Einfluss wird die Bedeutung, die Eltern durch ihren Anteil dem reibungslosen Ablauf des schulischen Alltags zuschreiben, von den meisten Elternteilen als „Zuständigkeit“ empfunden, wobei sie das angemessene Ausmaß dieser Zuständigkeit sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht selbst nicht richtig einordnen können. Hieraus lässt sich dann auch der oben geschilderte Umgang mit Verantwortung begründen, der also vielmehr in einer Unsicherheit denn in geplanter Handlungsabsicht liegt.
Die Feinanalyse der Kategorie „Belastungen“ ergab ein Bild des Auftretens verschiedener Ursachen, die sehr unterschiedlichen Dimensionen aufwiesen. Grundsätzlich jedoch lassen sich die Aussagen hierzu in drei wesentliche Ausgangssituationen einteilen:
→ Die mangelnden zeitlichen Potentiale der Eltern (hervorgerufen durch Berufstätigkeit, weitere Kinder und Familienmitglieder, die der Zuwendung bedürfen usw.) mit der Konsequenz, sich nicht ausreichend um schulische Belange kümmern zu können, was dann wiederum zu einem belastenden Gedanken unzureichender Unterstützung des eigenen Kindes führt: „Also der J. ist ja der Älteste und im achten Schuljahr und ich erwarte eigentlich von ihm, dass er sehr selbstständig ist, weil wir vier Kinder haben, und weil ich nach ihm einfach auch nicht mehr so gucken kann, wie das in der Grundschule war. Und da erwarte ich eigentlich schon selbstständiges Schaffen. Es ist halt auch mittags für die Hausaufgaben – da habe ich nicht die Zeit zum Nachgucken und wenn er kommt und er braucht Hilfe für Englischvokabeln oder so, klar das mache ich, aber ansonsten muss er muss er einfach selber arbeiten“.
Oft hat der Schulalltag zwar große Priorität im alltäglichen familiären Handeln, muss aber hinter beruflichen Aktivitäten der Eltern oder weiteren zu betreuenden Kindern im Haushalt zurückstehen. Als Folge ergibt sich eine Ambiguität im elterlichen Handeln, dass sich einerseits in einer sehr hohen Erwartung an schulische Leistungen der Jugendlichen ausdrückt „dass er die Weiterbildung machen soll auf jeden Fall nach der Realschule“, andererseits aber von den Eltern durch weitere Verpflichtungen nicht in ausreichendem Maße unterstützt werden kann „da erwarte ich eigentlich schon selbstständiges Schaffen“. Die Perspektive für die erfolgreiche Bewältigung des Schulalltags wird unter der Voraussetzung von Mehrfachbelastungen in die Hände der Jugendlichen selbst gelegt, wobei Eltern dadurch wiederum in die Verlegenheit des Umgangs mit Verantwortung geraten.
→ Die durch die Pubertät hervorgerufene mangelnde Disziplin der Jugendlichen selbst, die Eltern die Unterstützung nicht gerade erleichtert:
„Ich bin im Zwiespalt aber ja überwiegend mit den Kinder in Bezug auf Schule. Sagen wir mal so: Ich bin jetzt so zufrieden, es gab Phasen, wo die anstrengender waren, wo der M. auch keine Hausaufgaben gemacht hat, wo er mich dann belogen hat, wo er auch mal eine Unterschrift gefälscht hat. Aber das habe ich dann zum Glück vorzeitig rausgekriegt, bevor er das weitergereicht hat. Das war dann halt eben nicht so berauschend, aber mit ihm konnte ich es halt eben besprechen und das habe ich auch getan und da konnte ich auch mit dem Klassenlehrer drüber reden. An meine Tochter komme ich da gar nicht ran, also da bin ich froh, dass die gut klar kommt in der Schule und ihr Ding macht muss ich sagen. Und ich lasse sie auch jetzt gewähren, sagte ja, dass es eine Phase gab, wo wir nicht miteinander konnten, wo wir viel Zoff hatten“.
Das Phänomen „im Zwiespalt“ belegt das unterschiedliche erzieherische Handeln, dass sich aufteilt in Erziehungsziele für die Familie einerseits und Erziehungsziele für die Schule andererseits. Die Phase der Pubertät kommt somit eigentlich als drittes Ereignis hinzu, um die Situation der Bewältigung des Schullalltags innerhalb der Familie noch zu erschweren. Eltern werden folglich im Verlauf der Lebensphase Jugend mit Belastungen konfrontiert, die vielfältig sind, wobei sich die Belastung durch den Schulalltag als überdimensionaler Bereich darstellt.
→ Die gesellschaftliche Erwartung in Form von Leistungszentrierung, die sich institutionell in der Schule durchgesetzt hat und das Individuum hinter Zertifikaten anonymisiert und letztlich dazu führt, dass auch Eltern und SchülerInnen als Einzelkämpfer eine kooperative Bewältigung des Schulalltags vergessen lässt:
„Ich bin so wirklich froh, wenn ich mit Schule nichts mehr am Hut habe, weil es immer stressiger wird, also, wie soll ich das jetzt sagen: Weil es immer, also meiner Meinung nach, also ich bin vom Typ her vielleicht auch anders, die Gesellschaft zwingt ja dazu, dass du einen bestimmten Abschluss haben musst, also arbeitest du ja mit deinem Kind dahin, und das ist aber immer so Druck auf alle. Auf die Kinder, auf die Eltern, auf alle so ein Druck finde ich. Also dann denke ich immer, das ist ja echt schlimm, also ich empfinde das als ganz schlimm. Und wenn man dann da sitzt, und das nervt mich dann alles so. Also Elternabende, das hat mich bei meinem ältesten Sohn schon genervt. Und jetzt war ich beim P-Sohn. Dann sitzen Eltern da, die interessiert die Klasse überhaupt nicht, die interessiert nur ihr eigenes Kind, die reden den ganzen Elternabend nichts und zum Schluss wird dann das, was ihr Kind betrifft, das wird dann noch gesagt. Und dafür gehen die auf Elternabende, das hat mich dann so gestört, und dann habe ich gedacht, jeder ist so egoistisch und denkt nur noch, wie mache ich, dass mein Kind keinen Nachteil hat, wie bringe ich das dem Lehrer bei, wie der mit meinem Kind umzugehen hat oder wie schütze ich mein Kind vor irgend etwas. Also, die Leute interessiert nicht mehr, was auch andere Kinder betrifft, also die Erfahrung habe ich gemacht, sondern es kümmert sich jeder nur noch um sich, dass sein Kind nicht irgend einen Nachteil hat“.
Diese Reflexionen von Eltern sind Auseinandersetzungen mit den Erwartungen aus der gesellschaftlichen Umwelt und weisen auf Befürchtungen der Unvereinbarkeit mit solchen Ansprüchen hin. Selbst wenn es sich bei den für diese Untersuchung ausgewählten Eltern um solche handelt, deren Kinder auf Grund der bisherigen Schulleistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Realschulabschluss erreichen werden, können solche Befürchtungen nicht aufgehoben werden. Dieser Zustand wird letztlich auf der Makroebene erzeugt: Die ökonomisch ausgerichtete Leistungsgesellschaft setzt die Schule unter einen Erfolgsdruck, der schließlich an das Elternhaus weitergegeben wird.
Die elterliche Beschäftigung mit dem und die Begleitung durch den Schulalltag erweist sich somit als bedrückendes Gefühl, wie es im Umgang mit anderen „Jugendwelten“ nicht erkennbar wird. Eine eindeutige Abgrenzung der schulischen von der familiären Lebenswelt kommt in der Betonung „mit Schule nichts mehr am Hut habe(n)“ zum Ausdruck. Es gelingt Eltern offensichtlich nicht, diesen Lebensbereich als selbstverständlich und positiv in den Familienalltag zu integrieren. Verursacht wird diese Antiposition dadurch, dass Schule nicht als Bereicherung angesehen wird, sondern einen „Druck“ auslöst, weil „die Gesellschaft zwingt“.
Die theoretische Bedeutung von „nichts mehr am Hut habe(n)“ weist auf eine eindeutige Antiposition gegen eine außerfamiliäre Welt hin, so dass diese sich als technokratische Bezeichnung und als Indikator für die ganz offensichtliche Existenz einer Grenze zwischen Familie und Schule verwenden lässt.
Das thematische Ereignis, das an dieser Stelle mit dem zentralen Thema „Belastungen“ gekennzeichnet wurde, ist offensichtlich ein (gesellschaftlich) vorprogrammiertes Dilemma, das Familie und Schule nicht kooperativ zusammenführt, sondern voneinander entfernt. Andererseits zeigen die um Schule kreisenden belastenden Gedanken der Eltern auch eine Form der unbedingt notwendigen Form der Partizipation von Eltern und die Unmöglichkeit der vollkommenen Übertragung schulischer Angelegenheiten auf die Schule.
Die Teilung des erzieherischen Auftrages zwischen Familie und Schule stellt sich im Rahmen der empirischen Analyse der vorliegenden Daten nicht als Entlastung des Familiensystems dar, sondern als zusätzliche Belastung und schließlich auch als Abgrenzung unterschiedlicher humanitärer Auffassung dar, so dass die elterliche Wahrnehmung „wenn es nur noch um Leistung geht“ auf eine rezessive Reduktion des Menschen auf die Figur eines leistungszentrierten und produktiven Trägers gesellschaftlicher Erwartungen verweist.
Da es keinen offensichtlichen Ausweg aus diesem Dilemma gibt und sich jeder „Widerstand“ als Nachteil für den Einzelnen auswirkt, resultieren aus diesem belastenden Zustand bei den Eltern Enttäuschungen, da Eltern die Hoffnung auf Erfüllung der gesellschaftlichen Ansprüche nun auf die Institution Schule verlagern. Diese Enttäuschungen entstehen somit durch Erwartungen, die Eltern an Schule und LehrerInnen haben, die schulische Versorgung ihrer Kinder zu gewährleisten, die aber für Eltern in einem nicht befriedigenden Maße erfüllt werden (können).
Es ist sicherlich nicht denkbar, das wurde besonders im ersten und vierten Kapitel dieser Arbeit deutlich, eine Aufgabenteilung zwischen Familie und Schule zu erreichen. Dies verhindert bereits der inhaltliche Auftrag, den die jeweiligen Systeme zu leisten haben. Der hier von Eltern geschilderte Aspekt, unter dem die Schule zur „Last“ wird, weicht allerdings von dem Ziel ab, gemeinsam aber in spezifischer Art und Weise die Entwicklung von Jugendlichen zu fördern, sondern bestätigt vielmehr eine (in dieser Arbeit ausschließlich aus der Elternperspektive betrachtete) Arbeitstrennung.
Ganz deutlich wird jedoch die Unzufriedenheit mit dieser außerfamiliären Lebenswelt, wenn Eltern von Enttäuschungen sprechen, die sie im täglichen Schulalltag erleben. So ergibt sich ein weiteres Dilemma bei dem Versuch einer Konstruktion von Gegenseitigkeit.
7.2.4 Enttäuschungen, die Eltern ständig erleben
Unter dem Oberbegriff „Enttäuschungen“ werden die von Eltern als negativ empfundene Konfrontationen mit der Schule beschrieben, die das Familienleben wiederum belastend beeinflussen und nicht nur einmaligen Charakter haben. Die von Eltern geäußerten Enttäuschungen über den Schulalltag erweisen sich im Rahmen der Analyse als ein aktuelles, gleichsam aber auch andauerndes Thema im Familienleben, was sich durch entsprechende Anspruchshaltungen der Eltern – „Ich erwarte eigentlich von der Schule“ oder „dass die Schule nicht nur Wissensvermittler ist, sondern auch Perspektiven aufbaut“ – an die Institution Schule erklären lässt. Die folgende Interviewpassage zeigt ganz deutlich den hohen Anspruch, den Eltern an Schule haben und der wiederum geprägt ist vom Hintergrund der belastenden Situation mit Zukunftsängsten: „Die Schule sollte eigentlicher hier eine Vermittlerposition durchführen, das heißt, sie sollte den Kindern auch chancenorientiert bestimmte Dinge weitervermitteln, was einfach in der Zukunft sich abspielt, wie heute sich – ich sag mal – wirtschaftliche Situationen darstellen und darüber hinaus eben auch den Kindern eben die Möglichkeit offerieren, ein Zukunftsbild sich selber zu gestalten“.
Dass dieser hohe Anspruch an die Schule nicht in dem Maße erfüllt werden kann, erfordert schließlich, „dass hier ganz stark oder doch einfach sehr stark im Vordergrund das Elternhaus steht, das einfach in der Lage sein muss, zu erkennen, dass Kinder so weit wie möglich schulisch gefördert werden müssen, um einfach den Anforderungen der Zukunft standhalten zu können“.
Ebenso wie die zuvor beschriebenen „Belastungen“, die in der Familie durch das Schulleben entstehen, sind auch die Ursachen der elterlichen Enttäuschungen vielfältiger Natur. Innerhalb der Analyse der vorliegenden Fälle lässt sich hierbei feststellen, dass es nicht ausschließlich – wie im oben zitierten Beispiel – überwiegend die schulleistungsabhängigen Bedingungen sind, die schließlich in absehbarer Zeit zu einem qualifizierten Schulabschluss führen, sondern um „Grunddinge, die in der Schule einfach falsch laufen“. Einschränkend dazu muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den analysierten Elternfällen ausschließlich um Eltern handelt, deren Kinder eine Schulklasse besuchen, die im Untersuchungszeitraum einen erheblichen Unterrichtsausfall durch eine mangelhafte Personalsituation zu beklagen hatten. So können die von den Eltern geäußerten Enttäuschungen zwar auf den ersten Blick durch dieses schulorganisatorische Problem erklärt werden, interessant für den Zusammenhang mit der Untersuchungsfrage sind aber vielmehr umfassendere Hintergründe, die solche Enttäuschungen auslösen und die auch über den Rahmen des aktuellen Schuljahres von den meisten Eltern thematisiert wurden.
Enttäuschungen zeigen sich in der Mehrzahl der Fälle als Resultat einer spannungsgeladenen Verkoppelungs- und Abgrenzungsfrage zwischen den Erziehungsinstanzen Familie und Schule, wobei die Familie auf der einen Seite ihre familientypische Rolle in das erzieherische Handeln aufrechterhalten und auch über familiäre Angelgelegenheiten hinaus übernehmen möchte – „die Frage der Schule bei uns in der Familie zu klären“, auf der anderen Seite aber nach der Unterstützung schulinstitutioneller Erziehungsbeteiligung verlangt: „Dass die Lehrer ihnen zeigen, wo’s lang geht“. Durch die nicht erfüllte Erwartungshaltung der Eltern mit der einhergehenden Enttäuschung erhalten sie eine Differenzierung hinsichtlich der Lebenswelten von Jugendlichen aufrecht (21) und sind der ständigen Unsicherheit „soll ich mich da mehr einklinken oder nicht“, „vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken“ erlegen.
Die wesentlichen Ursachen, die auslösend sind für die in der Familie erlebten und durch Schule ausgelösten Enttäuschungen lassen sich unter den von Eltern erwähnten Aspekte nun wie folgt gruppieren:
– Die Schule wird einer ihrer fundamentalen Aufgaben mit „edukativen Charakter“ nicht gerecht, so dass dieser Auftrag den Eltern schließlich zusätzlich angehaftet wird.
– Die Bezugsperson LehrerIn steht in einer wesentlichen Lebensphase für Jugendliche nicht in dem Maße zur Verfügung, wie Eltern dies erwarten: „dann wäre das ganz wichtig, dass sie dann einen Lehrer haben, wo sie festen Halt haben[…]und das war halt jetzt auch nicht gegeben.“.
– Die soziale Wertorientierung, wie sie in der Familie noch vorhanden ist, hat durch die schulischen Strukturen eine egozentrische Wendung im mitmenschlichen Handeln eingenommen, so dass ein gemeinschaftliches Gefühl, wie es im zwischenmenschlichen familiären Handeln vorhanden ist, innerhalb der Schulklasse verloren geht: „also die sind nur noch mit sich beschäftigt, so dass ihr Kind keinen Nachteil hat, weil ihr Kind soll ja weiterkommen“.
Ein Versuch, die unterschiedlichen familiär- und schulisch-pädagogischen Prinzipien und Methoden auf einen für alle zufriedenstellenden Nenner zu bringen und somit eine Synthese im Sinne eines pädagogischen Auftrages von Familie und Schule zu erreichen, ist als aussichtslos anzusehen und im Rahmen der in den ersten Kapiteln beschriebenen Differenzen der beiden sozialen Systeme auch nicht wünschenswert. Ein solcher Anspruch muss auch sicherlich als absurder und gravierender Denkfehler angesehen werden, da die Schule niemals das leisten kann, was die Familie leistet und umgekehrt. Und obwohl diese Differenzen von Eltern erkannt und aufrechterhalten werden, entstehen Enttäuschungen als offenbar unerfüllte Erwartungshaltung der Eltern. Insofern sind die zum Ausdruck gekommenen Erwartungen der Eltern an die Schule unter einer anderen Perspektive zu betrachten. Innerhalb der analysierten Elterninterviews sind enttäuschte Erwartungen als indirekte persönliche Erfahrungen mit dem Schulalltag zu erfahren, wobei auch das kooperative Handeln mit anderen Eltern beklagt wird: „Jeder ist nur noch mit sich selbst beschäftigt“.
Weiterhin fällt im Rahmen der Analyse auf, dass Enttäuschungen dann quasi vorprogrammiert sind, wenn negative Vorerfahrungen vorliegen, die Eltern mit ihrer eigenen Schulzeit verbinden. In vielen Fällen wirkt dieses Erlebnis offenbar so traumatisierend, dass Eltern auch zur aktuellen Schulsituation ihrer Kinder kein positiv gefärbtes Verhältnis aufbauen können „Von daher habe ich einfach auch schon eine negative Einstellung auch zur Schule gehabt und ich habe eh zu Lehrern eine negative Einstellung gehabt, wie ich einfach eine schlechte Schulzeit hinter mir hatte[…]in G-Dorf, die Lehrer die haben mich auch geschlagen, ja, also ich habe da ja einiges abgekriegt und von daher dachte ich auch, ihr Lehrer ihr könnt mich alle mal. Ich habe einfach eine Abneigung“.
Wenn Eltern jedoch erkennen, dass ihre Kinder solche Probleme im Umgang mit dem Schulleben offensichtlich nicht aufkommen, so versuchen sie zumindest, ihnen ein freies und unvoreingenommenes Handeln und Erleben als SchülerInnen zu ermöglichen und somit einen eigen Weg zu eröffnen. Als Beispiel hierfür steht der Textabschnitt aus dem Interview mit der Mutter einer Schülerin, die ihre negative Schulerfahrung durch das gesamte Gespräch hinweg immer wieder erwähnt und ihre aktuelle Abneigung und ihre Distanzierung gegenüber des Schulalltags ihrer Tochter hierdurch begründet, ihrer Tochter jedoch die Möglichkeit der persönlichen Bewältigung des Schullebens überlässt:
„Ich bin erstaunt, wie gut die V. (Tochter) mit den Männern da kann, mit denen ich Huddle hatte. Und ich habe auch nie zu ihr was gesagt, du hör mal zu, der ist ja wohl bescheuert oder so. Ich dachte nur für mich, es geht doch“.
Das Thema „Enttäuschung“ kann zusammenfassend für die im Rahmen dieser Arbeit analysierten Fälle im Sinne einer Nichterfüllung auch solcher Erwartungen bezeichnet werden, die über organisatorische und die oftmals erwähnte partikulare Interessenwahrnehmung der Eltern mit dem Ziel des Statuserhalts bzw. Statusaufstiegs (22) hinausgeht und somit auch auf den Wunsch einer emotional geprägten Beteiligung und Unterstützung durch die Schule und die weitere Elternschaft verweist. Mit der Nicht-Erfüllung solcher Ansprüche entfernt sich die Familie schließlich von der Schule: Anspruch und Realität führen folglich zu jener Kluft, die die Schule für Eltern als außerfamiliäre Welt erscheinen lässt, der sie über Jahre nicht entrinnen können, zu der sie schließlich aber deutliche eine Distanz aufbauen.
7.2.5 Distanzierung von schulischen Gegebenheiten, die als familienfremd erscheinen
Das letzte zentrale Thema im empirischen Theoriegebilde der „anderen Welt“ stützt sich auf die individuellen Konsequenzen, die Eltern vornehmen, um eine gewisse Abgrenzung zur Lebenswelt Schule zu erreichen. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht dabei die Frage, wie Eltern mit den zuvor thematisierten Enttäuschungen und Belastungen umgehen, welche die tägliche Auseinandersetzung mit dem Schulalltag im familiären Geschehen mit sich bringt und die schließlich zur Distanzierung des einem von dem anderen System führt.
Die Bezeichnung „Distanzierung“ darf aber an dieser Stelle nicht im Sinne einer vollständigen Abwendung vom Verlauf des Schulalltags verstanden werden, es handelt sich vielmehr um Strategien, die zumindest scheinbar eine Erleichterung schaffen, um schulisch bedingten Enttäuschungen und Belastungen widerstehen zu können. Eine absolute Distanzierung kann auch schon deswegen ausgeschlossen werden, da aus dem geäußerten „Gewissenskonflikt“ eine offensichtliche Reflexion des Themas Schulleben erkennbar wird und die emotionale Beteiligung sowie elterliches indirektes Engagement hervorgeht.
Distanzierung stellt sich deshalb in diesem Zusammenhang als eine Abgrenzung der familiären von der schulischen Lebenswelt dar, als Ausdruck einer bestehenden Hilflosigkeit der Eltern im Umgang mit Schule kennzeichnet.
Vielfach resultiert die Entfernung von einer direkten Beschäftigung mit dem Thema Schule aus Erfahrungen, die Eltern bereits über mehrere Jahre gemacht haben. So kann es sein, dass eine hoch motivierte Einstellung seitens der Eltern beim Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule durchaus vorhanden war, welches sich dann aber nach kontinuierlichen Negativerlebnissen legt – „das wird ja dann einfach mit den Jahren weniger“ und schließlich in einem herbeigesehnten Finale der Schulzeit endet – „Ich bin auch froh[…], wenn das mit der Schule endlich ein Ende hat, es steht mir hier.“
Aus dem Code „Ich habe mich ja schulisch immer mit unserem D-Sohn beschäftigt und habe irgendwann keine Lust mehr gehabt, mich schulisch zu beschäftigen mit dem P-Sohn. Irgendwann wollte ich das nicht mehr und da habe ich zu meinem Mann gesagt, du machst das jetzt[…]ich gehe auf keinen Elternabend mehr, auf keinen Elternsprechtag mehr, also das habe ich jetzt an meinen Mann ganz abgegeben“ geht eine individuelle Distanzierung der Mutter vom Schulalltag hervor, die gleichzeitig durch eine längere Beteiligung am Schulleben und der Beschäftigung mit der Schule legitimiert wird – „Ich habe mich ja schulisch immer mit unserem D-Sohn beschäftigt“. Erkenntnisse aus schulischen Erfahrungen mit dem älteren Sohn führen zu einer selbstreferentielle Auseinandersetzung mit der Familienumwelt Schule und schließlich zu dem Ergebnis einer individuellen Abgrenzung, innerhalb dieser Familie wird jedoch eine vollständige Loslösung der Eltern vom Schulalltag verhindert. Diese ständig zirkuläre Anbindung an das Verantwortungsgefühl wird durch den Einsatz einer „Ersatzperson“ für die schulischen Angelegenheiten deutlich – „und da habe ich zu meinem Mann gesagt, du machst das jetzt“.
In einem anderen Fall kommt die Separation von Familie und Schule sehr viel deutlicher zum Ausdruck: „Da war für mich einfach der Ofen aus“ stellt sich als Indikator für eine radikale Loslösung vom schulischen Geschehen dar. Die Frage Familie oder Schule kann durch die bestehende Schulpflicht zwar prinzipiell nicht gestellt werden, es erfolgen jedoch informale und individuelle Strategien dieser Entscheidungsfrage.
Wenngleich in diesem Beispiel die Ursache Distanzierung vom Schulalltag auf eine Unzufriedenheit mit LehrerInnen begrenzt wird, so ergibt er sich doch im gesamten Verlauf des Interviews die Formulierung einer lebensweltliche Divergenz, die schließlich in ihrer Bedeutung Familie und Schule als nicht zu vereinbare Lebenswelten darstellt.
Vereinnahmt von den Eindrücken einer Institution, die scheinbar mit der Lebenswelt Familie kein übereinstimmendes und annähern adäquates Weltbild erreichen kann, erscheint die Schule den Eltern „wie eine Andere Welt“, und bietet sich als Erklärungsmuster für innerfamiliäre Probleme an „das hängt ja auch mit der Schule zusammen“.
Die Gewichtung von Belastungen, Ärger und Sorgen scheint das Familienleben so stark zu determinieren, dass das Ende der Schule herbeigesehnt wird. „Ich bin auch froh[…}, wenn das mit der Schule endlich ein Ende hat, es steht mir hier“. Eine derartige Feststellung weist auf eine Entkräftung hin und ist als Ergebnis permanenter Unzufriedenheit anzusehen und erscheint dem wissenschaftlichen Beobachter als von Elternteilen personifizierte Form eines Abgrenzungsprozesses. Mit der Erwartung des Endes der Schulzeit und der Hoffnung auf eine „Erlösung“ von evidenten Strapazen, die der Schulalltag dem Familienleben auferlegt, ist jedoch eine endgültige Erleichterung nicht zu erwarten, da im Bewusstsein weiterhin die Bedeutung der Schule für den weiteren biographischen Verlauf permanent vorhanden ist.
Die Abwendung auf der einen und das stark ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein auf der anderen Seite hebt die Konstruktion von „geteilten“ Lebenswelten hervor: Die Verantwortung kann in diesem Sinne als familiäre Handlung für das Wohlergehen des eigenen Kindes angesehen werden, die „Andere Welt“ Schule mit ihren organisatorischen und strukturellen Gegebenheiten scheint dieses Handlungskonstrukt jedoch zu stören.
Zusammenfassend kann nun das Ergebnis der bisherigen Konzeptualisierungsanalyse in einer Hypothese folgendermaßen dargestellt werden: Je nach dem Grad der Belastung, die Eltern in der täglichen Auseinandersetzung mit dem Schulalltag in der Familien empfinden, ergeben sich unterschiedliche Varianten im Umgang mit dem Schulalltag, die schließlich bis zur persönlichen Distanzierung vom Schulleben reichen. Das Modell der „anderen Welt“ steht sowohl für das persönliche Erleben der Eltern im Umgang mit der Schulwelt ihrer Kinder wie auch für die Distanz, die sie zum Schulalltag aufzubauen versuchen und weist auf eine scheinbare Unmöglichkeit im Erreichen einer Annäherung der Lebenswelten Familie und Schule hin. Individuelle Vorstellungen und Wünsche der Eltern, die einen solchen unzufriedenstellenden Zustand aufheben könnten werden in Äußerungen wie „ich würde mir wünschen“ oder „das habe ich mir anders vorgestellt“ aber durchaus deutlich.
Mit der Entwicklung dieser vier Hauptkategorien, die in einem komplexen Arbeitsprozess aus vielen weiteren Subkategorien schließlich als wesentliche Themen beim Umgang der Eltern mit dem Schulalltag ihrer Kinder entwickelt wurden, kann nun mit der Integration dieser zentralen Themen zur einer Grounded Theory begonnen werden.
Dazu ist es notwendig, eine Kernkategorie zu finden, die schließlich als alle anderen Kategorien übergreifend angesehen und die Ausgangsfrage der Inklusion der schulbezogenen Kommunikation umfassend thematisieren kann.
7.3. Die Integration der generierten Hauptkategorien: Eine theoretische Skizze zur Frage der Inklusionsvorgänge im System Familie
Nachdem nun die aus der Datenanalyse zusammengefassten wesentlichen Kategorien gruppiert und ihre Bedeutung durch das empirische Material ersichtlich wurde, soll nun auf dem Weg zu einer gegenstandsverankerten Theorie der Schritt einer Integration dieser Kategorien vollzogen werden, so dass schließlich ein Bild der Realität hinsichtlich der Inklusion, im durchgängig verstandenen Sinne von Teilhabe der Eltern (als Adressaten familiärer Kommunikation) an schulbezogener Kommunikation entstehen kann. An dieser Stelle kommt das prozesshafte und diskursive Wesen der zu entwickelnden Theorie und ihrer Präsentation in Vorschein, d.h. ihre Offenheit, Komplexität, Angemessenheit und theoretische Relevanz.
Im Umgang mit den Daten bedeutet dies, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen: Mit dem im Verlauf der Datenanalyse erreichten Verstehen der Zusammenhänge der tatsächlichen Teilhabe der Eltern an Kommunikationsprozessen des Schulalltags, die durch ihre Kinder als Adressaten schulbezogener Kommunikation in das System Familie gebracht werden, verlasse ich die Ebene einer mit dem Schulsystem verbundenen zu einer mehr offeneren Forscherin, die objektiv die innere logische Konsistenz der bisher konstruierten theoretischen Skizze weiter entwickeln kann. So ist es möglich, das Phänomen Eltern als Adressaten schulbezogener Kommunikation auf Grundlage einer logischen Binnenstruktur und den Konturen der materialen Theorie durch ein wesentliches Element der Grounded Theory, der Integration zu fundieren (23).
Die Integration der Kategorien zu einer Grounded Theory kann in mehreren Schritten erfolgen, die miteinander verwoben sind und somit nicht getrennt durchgeführt werden können. Innerhalb dieses Arbeitsprozesses wird die Geschichte um die ausgewählte Kernkategorie konzeptualisiert und mit weiteren Kategorien auf der Basis eines Paradigmas systematisch in Beziehung gesetzt. Um die Beziehungen zwischen den Kategorien zu validieren, wird wiederum das empirische Datenmaterial herangezogen. Kategorien, die der weiteren Verfeinerung und Entwicklung bedürfen, werden aufgefüllt.
Vor dem Hintergrund der bisherigen Analyse und durch die Bewältigung eines umfassenden und komplexen Arbeitsprozesses – des Kodierens der Daten nach den so genannten sechs C’s (24) von Glaser (1978) – kann nun im Rahmen des selektiven Kodierens die Integration eines theoretischen Schemas gelingen. Als „Cause“ werden dabei die ursächlichen Bedingungen für das Auftreten des Hauptphänomens der „Anderen Welt“ bezeichnet, „Covariances“ stellen die multiplen Variablen der ursächlichen Bedingungen dar, die Einfluss auf das soziale Phänomen nehmen. Der „Context“ benennt die engen und weiten kontextualen Bedingungen, „Conditions“ sind motivationale und umweltbezogene Handlungseinheiten der Betroffenen, die zu konkreten Folgen, d. h. zur Handlung oder Nicht-Handlung führen, den „Consequences“.
Veränderungsmöglichkeiten von Bedingungen durch prozesshafte Entwicklungen schließlich bezeichnet Glaser mit dem Begriff der dynamischen Komponente, „Contingent“, die auf einen Wandel in den Bedingungen durch prozesshafte Entwicklungen hindeutet. Ändern sich also die ursächlichen oder intervenierenden Bedingungen, so kann dies zu neuen Handlungen führen – „Wenn es Probleme in der Schule gäbe, ich wäre sofort da“.
Abb. VII.6: Theoretisches Schema zum familiären Umgang mit dem Schulalltag bzw. zur Konstruktion einer „Anderen Welt“ aus der Perspektive der Eltern von jugendlichen SchülerInnen
Kontextuale Bedingungen (Context) gesellschaftlicher Natur:
Ökonomisch orientiertes Leistungsgesellschaft die der Schule eine Allokations- und Selektionsaufgabe auferlegt
individueller Natur:
Mehrfachbelastung durch Familie, Berufstätigkeit, Lebensphase Jugend und Pubertät
Ursächliche Bedingungen (Causes):
Sorgen und Ängste, die aus den gesellschaftlichen Anforderungen und deren Übertragung auf die Institution Schule entstehen.
Das Bestehen der außerfamiliären Lebenswelt Schule als „Konkurrenzinstanz“. Angst vor Verlust der familiär geprägten Werte.
Intervenierende Bedingungen (Covariances):
Enttäuschungen, die als Erfahrungswert dem aktuellen Umgang mit schulisch-verantwortlichem und partizipierendem Handeln entgegenstehen oder es beeinflussen
Handlungseinheiten der Eltern im Umgang mit dem Schulalltag (Conditions):
Verantwortungsmanagement im Elternhaus auf produktiver, bedarfsorientierter oder einseitig übernehmender/Übertragender Basis
Konsequenzen (Consequences):
Differenzierung de Lebenswelten Familie und Schule bis hin zu einer Distanzhaltung zum schulischen Alltag
Prozesshafte Entwicklungen (Contingent):
Veränderungen hinsichtlich des Verantwortungshandelns
Relativierung des Familie-Schule-Verhältnisses
Die zuvor dargestellten zentralen Phänomene, die bisher als „Hauptthemen“ der analysierten Elterninterviews eng am Datenmaterial erläutert wurden, sollen im Folgenden auf einer abstrakteren Ebene präzisiert und als Begründungsgrundlage für die seitens der Eltern vorgenommenen Differenzierung in zwei Welten herangezogen werden.
Ängste und Sorgen, die Eltern im Zusammenhang mit dem Besuch der weiterführenden Schule entwickeln (25) und die mit dem Erkennen der bevorstehenden sozialen Statuspassage ihrer Kinder einhergehen, lassen sich primär als Bedingung gesellschaftlicher Makrostrukturen ansiedeln, die Bildungskarrieren Heranwachsender prädeterminieren und schulische Erfolge für einen „erfolgreichen“ weiteren Lebensweg voraussetzen. Die Ängste der Eltern entstehen somit einerseits durch den möglichen schulischen Misserfolg ihrer Kinder, da schließlich auch die familiären Bedingungen hierfür verantwortlich gemacht werden können, auf der anderen Seite durch Befürchtungen einer unzureichenden organisatorischen und persönlichen Versorgung des eigenen Kindes bei der unausweichlichen Übertragung von Erziehung und Bildung an die Schule. Der konkrete Familienalltag kann einer solchen Realität nicht ausweichen und sieht sich konfrontiert mit Ansprüchen und Anforderungen einer anderen Lebenswelt, die zu Problematisierungen und Störungen des familiären Ablaufs führen können.
Innerhalb des untersuchten Themenbereichs zeigen sich die kontinuierlich vorhandenen Ängste der Eltern als ein Problem, wenn nicht sogar als ein Hindernis, die Schule als Bereicherung durch sozialen und kognitiven Wissenszuwachs des eigenen Kindes anzusehen. Mit einer solch problematisierenden Einstellung wird das Schulleben auf eine Belastung des familiären Alltagslebens reduziert. Hinzu kommen über die gesellschaftlichen Anforderungen hinaus die auf individueller Basis anzusetzenden kontextualen Lebensumstände und –bedingungen, die im Lebensalltag der Eltern zu einer Verschärfung der belastenden Situation führen. So stehen dem Anspruch einer ausreichenden Betreuung von jugendlichen SchülerInnen die Verwirklichung des Selbst der Eltern und gleichermaßen eine ausgewogene Familiensituation gegenüber. Im Unterschied zu den von außen an die Familie herangetragenen gesellschaftlichen Anforderungen treten Belastungen in Form selbst auferlegter schulbezogener Aufträge bei Eltern hervor, die einer innerfamiliären Lösung und Bearbeitung bedürfen.
In diesem Spannungsfeld entsteht schließlich durch die Reflexion eines inhaltlich differenzierten Erziehungshandelns die grundsätzliche Frage des Umgangs mit der Verantwortung für Sozialisations- und Erziehungsleistungen, die offensichtlich nicht vom Elternhaus alleine bewältigt werden können und sollen. Der handlungsbezogene Umgang mit Verantwortung begründet sich wiederum im Konflikt der elterlichen Handlungsoffensive und der bewussten Wahrnehmung des schulischen Monopols für die Vergabe von Abschlusszertifikaten. Mit dieser Konfrontation ergibt sich für Eltern die Frage nach dem „richtigen“ Verantwortungshandeln. Da schulisch-unterrichtliche Inhalte den elterlichen Verantwortungsrahmen zu übersteigen scheinen, und die Jugendgeneration unter einem Erziehungsziel der Individualisierung und Autonomie aufwächst, findet auf der konkreten Handlungsebene ein von Fall zu Fall differierender Umgang mit der Verantwortung für den Schulalltag statt, der jedoch in seiner Ausprägung stets hinterfragt bleibt.
Das Phänomen Verantwortung steht bei allen Interviews im Mittelpunkt der elterlichen Auseinandersetzung mit dem Schulalltag und zeigt sich in Form eines differierenden Handlungsmusters, welches das Bewusstsein über die unausweichliche individuelle Übernahme der Verantwortung in einen Gegensatz zu dem reaktiven Ausweichen aus dem aktiven Verantwortungshandeln stellt. Aus dieser scheinbaren Unvereinbarkeit der elterlichen Fürsorge und emotionalen Handelns „man will ja eigentlich nur das Beste“ entsteht schließlich das Gefühl eines Ausschlusses aus dem schulischen Geschehen. Mit Äußerungen wie „Ja mit den Schulsachen da hat man ja auch nicht mehr so viel Einfluss drauf“ wird deutlich, wie Eltern eine Ausgliederung aus dem Schulalltag erleben und gleichermaßen zur Abgabe der Verantwortung veranlasst werden. Der Umgang der Eltern mit diesem Ausschlusssignal stellt aber keinesfalls eine erleichternde Situation dar, die Belastungen oder Ängste zu relativieren vermag. Vielmehr kommt es zu in diesem Zusammenhang zu einer weiteren belastenden Situation, die als Resultat der gewollten oder ungewollten Verantwortungsabgabe an eine Institution zusehen ist, die den Erwartungen der Eltern nicht gerecht werden kann.
Wenn von Enttäuschungen die Rede ist, so handelt es sich dabei um vor allem um emotionale Aspekte und solche, die eine reflexive Verarbeitung mit dem schulorganisatorischen Alltag betreffen. Dabei wird noch einmal der verantwortungshandelnde Umgang mit den Erwartungshaltungen der Eltern an die Institution Schule in Zusammenhang gebracht. In vieler Hinsicht deutet das Ergebnis der Reflexion auf eine unbefriedigende Konstellation hin, wobei Konstruktionen schulalltäglichen Handelns als unbeeinflussbar empfunden werden. Damit reduziert sich die Schule für Eltern auf eine auf bürokratische Strukturen begrenzte Institution, die ihre eigenen Kinder aus dem lebensweltlichen Familienkontext zunehmend auslagert und den Schulalltag zum Selbstzweck werden lässt und Familie und Schule eindeutig trennt. Eine eindeutige Sinnbedeutung kann dem Schulalltag dann nicht mehr zugewiesen werden. Die vielfach beschriebene „Krise der Schule“(26) erhält somit ihre Argumentation nicht nur durch die Ausgrenzung spezifischer Selbstanteile der SchülerInnen selbst, sondern ebenso durch den subjektiven Sinnverlust, den Eltern im Umgang mit dem Schulalltag erleben müssen.
Die Verarbeitung und Bewältigung des Schulalltags in der Familie erzeugt unter diesen Umständen bei Eltern das Gefühl der Entfremdung, da familiäres und schulbezogenes Handeln keine Passung zeigen. Dies führt schließlich zur Konsequenz einer Distanzierung zu schulischen Angelegenheiten, die von Eltern in unterschiedlicher Ausprägung vollzogen wird. Distanzierung bedeutet in diesem Sinne etwa eine Abwendung von direkter Partizipation, Ablehnung der Übernahme funktioneller Mitwirkungsrollen (etwa als ElternsprecherIn) oder aber im weiteren und allgemeinen Sinne die Entfernung vom Schulalltag durch die „Verteilung“ der Verantwortung. Eine vollständige Distanzierung gelingt jedoch in keinem Fall, da die Familie durch die aufgezeigten parallelen Entwicklungen der ausgedehnten Jugendphase und der Bedeutungszunahme des Bildungssystems quasi unausweichlich in den Schulleben einbezogen wird. Wenngleich eine funktionale Partizipation zu verhindern ist, ist der schulnahe emotionale und auch verantwortungsbezogene Bereich für Eltern unausweichlich.
7.3.1 Resümierender Überblick
Die Kernproblematik der Inklusion als Teilhabe der Eltern an schulbezogener Kommunikation liegt systemtheoretisch betrachtet, wie die bisherige Analyse der Hauptkategorien ergeben hat darin, dass die Teilhabe an schulbezogener und damit primär außerfamiliärer Kommunikation nicht von den Eltern selbst gesteuert werden kann. Sie sind unausweichlich als Personen Adressaten der Kommunikation beider Systeme, wobei die Kommunikation sich selbst immer und immer wieder aufs Neue selbst produziert, fortsetzt und dadurch die Systeme in ihrer Existenz aufrechterhält. Im diesem Sinne ist es für das System Familie nicht möglich, das re-entry anderer Systeme zu vermeiden. Befinden sich im Familiensystem Personen, die ebenso Adressaten schulbezogener Kommunikation sind (SchülerInnen), so ist die Teilhabe an dieser systemfremden Kommunikation vorprogrammiert. Erst mit dem Verlassen des Systems Schule (Ende der Schulzeit) ist damit zu rechnen, dass die familiäre Kommunikation durch die schulbezogene Kommunikation nicht mehr irritiert wird.
Ich möchte an dieser Stelle die systemtheoretische Ebene verlassen und die eben beschriebene Irritation weiter im Sinne der Datenanalyse fortsetzen: Eltern befassen sich mit der Lebenswelt ihrer Kinder nicht nur aus einer Perspektive. Die Betrachtung geht über den leistungsbezogenen und organisatorischen Aspekt der Schule hinaus und mündet in eine humanemotionale Erwartung an die Schule bzw. eine Nichterfüllung dieser Erwartungen, die mit einer Enttäuschung einhergeht. Diese erlebten Enttäuschungen lassen innerhalb des Elternhauses Bewältigungsmethoden entstehen, um eine Erleichterung des zuvor beschriebenen Spannungsverhältnisses herbeizuführen. Diese Strategien zeigen zwar keine einheitliche und völlig kongruente Tendenz, spielen sich aber eindeutig auf unterschiedlichen Dimensionen des Verantwortungshandelns ab. Bisher wurde der Umgang mit Verantwortung von Eltern für den schulischen Alltag ihrer Kinder auf einer Skala von unterschiedlichen „Verantwortungstypen“ eingeteilt, wobei der Hinweis auf das Fehlen eines durchgängigen Typus bereits gegeben wurde. Tatsächlich hat sich der Umgang mit Verantwortung innerhalb dieser Untersuchung als ein sehr wechselhafter Prozess erwiesen, wobei die Art und Weise der Verantwortungsstrategie eine Veränderung überwiegend auf einer zeitlichen Achse des Schulverlaufes andeutet: Während die Anfangszeit der weiterführenden Schule noch sehr stark von einer seitens der Eltern dominierten Verantwortungsübernahme geprägt ist „Im zweiten und dritten Schuljahr da war ich im Elternbeirat und da haben wir uns auch ziemlich oft getroffen, wodann jeder auch sagen konnte, wie er sich das vorstellt“, wandelt sich dies im Verlauf der weiteren Schuljahre zu einem Bild der Verantwortungsabgabe an die Schule und LehrerInnen und an die eigenen Kinder „Man kann als Eltern eigentlich nur noch unterstützen[…]das wird ja einfach mit den Jahren weniger“.
Unproblematisch stellt sich der Umgang mit Verantwortung für Eltern nicht dar, was sich durch Doppelrolle der Eltern erklären lässt. Eltern wollen und können auf der Ebene des familiär- sozialen Handlungsfeldes Verantwortung nicht völlig aus ihrer Hand in die der Institution Schule geben, als Eltern von Schulkindern am Ende ihrer ersten weiterführenden Schullaufbahn erfassen sie jedoch die gesellschaftlich definierten Ansprüche an jugendliche SchülerInnen und die Tatsache, dass diese ausschließlich auf schulisch-organisatorische Ebene erreicht werden können.
Diese zentralen Themen, welche die Beschäftigung mit dem Schulalltag im Elternhaus kennzeichnen, bedingen einander und führen schließlich zu einer Distanzierung der Eltern vom Schulalltag. Für Eltern wird die Verschiedenheit von familiärem und schulischen Handeln so unvereinbar, dass sie die Schule als externe, als „andere Lebenswelt“ definieren, auf die sie wenig Einfluss ausüben können. Trotzdem bleibt das schulische Geschehen nach wie vor ganz nah mit dem Familienleben verbunden, so dass nur das Bewusstsein über ein Ende dieser Begegnung mit dem Ende der Schulzeit als erreichbares Ziel Erleichterung verschafft. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Inklusion eher als notwendiges Übel angesehen werden, so dass der Effekt einer Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Schulleben bzw. einer Bereicherung durch den „Weltenzuwachs“ ausbleibt.
Ein wichtiger Aspekt zu einem solchen Exklusionsverhalten soll an dieser Stelle vergegenwärtigt werden, um den einschränkenden Charakter, der hier auf die Teilhabe der Eltern an Schule zu erweitern: So sind es nicht nur Eltern, die eine Abgrenzung zum und Ausgrenzung aus dem schulischen Alltag auf Grund des belastenden Kontextes anstreben, es hat sich auch in vielen Beiträgen der befragten Eltern ein Ausschluss seitens der Schule dargestellt, wobei Eltern den Handlungsablauf von schulischer Seite nicht mehr verstehen und akzeptieren können. Ich möchte dies an einem Fall plausibel machen, dem sachlich nur eine Kleinigkeit zu Grunde liegt, die aber gerade in seiner Auswirkung auf die Distanzierung der betroffenen Mutter zum schulischen Alltag erheblich wirkte:
„Das war zum Beispiel in Kunst, da sollten sie so ein Steinmännchen machen. Und das sollten sie aber zu Hause machen, und das war gar nicht in der Schule. Ja und dem J-Sohn fiel das dann noch ein mit den Steinen, und da sind wir abends noch raus und haben die Steine gesammelt und haben dann noch geguckt. Ja, die haben sie dann mitgebracht und dann hieß es, also zu Hause fertig machen. Ja und dann hat er also so einen Frosch gemacht, der war auch ganz schön. Aber mit dem Kleber, das hält dann ja auch nicht so gut und dann gab’s Spezialisten, die haben ein fertiges Steinmännchen irgendwo her, das war lackiert und die bekamen dann eine gute Note dafür. Also ich das fand das chaotisch und dann wurde das so abgetan, und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Also das war, na ja dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken drum. Dann ist das halt so. Und dann war noch irgendwas mit einem Aufsatz und dann habe ich halt gedacht, vielleicht liegt’s an mir. Ich weiß nicht. Na ja, und danach hatten wir auch nie mehr einen Elternstammtisch.“ Für den Familienalltag bedeuten solche Erfahrungen von Eltern, die sich dem Schulleben gegenüber engagiert zeigen, in erster Linie eine große Enttäuschung von ihrer Vorstellung der konkreten Bereiche schulische Organisation – „und dann hieß es also, zu Hause fertig machen“ – sowie einer für sie nicht nachvollziehbaren Leistungshonorierung „die bekamen dann eine gute Note dafür“. Der Widerspruch zwischen familiärem und schulischem Gerechtigkeitssinn ist nur ein Beispiel des Auseinanderklaffens von Werten und Funktion der beiden Institutionen. Die Folge solcher Differenzierungen, die aus der Infragestellung von familiär geprägten Werten (Gerechtigkeit, Lob für gute Leistung usw.) hervorgeht – „vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken drum“ – besteht nicht in der Übernahme oder Akzeptanz schulisch gelebten Alltags, sondern in einer Entfernung der Eltern von dem, was mit Schule zu tun hat – „danach hatten wir auch nie mehr einen Elternstammtisch“, obwohl das angestrebte Ziel des guten Schulabschlusses das gleiche ist.
7.3.2 Empirische Modellierungen der Distanzierung vom Schulalltag
Um eine Verdeutlichung des zentralen Konzepts der elterlichen Distanzierung zum Schulalltag ihrer Kinder zu erreichen, sollen nun anhand des empirischen Datenmaterials die multiplen Umsetzungsstrategien exemplifiziert und somit auch die Bedeutung des Begriffes Distanzierung erarbeitet werden. Ausgehend von der am Datenmaterial erläuterten inhaltlichen Bedeutung von Distanzierung lässt sich dazu bereits feststellen, dass diese nicht im Sinne einer unzuverlässigen Elternrolle verstehen lässt. Eine interessante Bedeutung erfährt das Konzept der Distanzierung vor allem deshalb, da es im Verlauf des Schullebens als Prozess der Wendung angesehen werden kann und mit steigender Tendenz bis zum Untersuchungszeitpunkt, zu dem die SchülerInnen die achte bzw. neunte Klassenstufe besuchten, zumindest einen ersten Höhepunkt erreicht hat.
Im Vorfeld dieser Feinanalyse kann durch die bereits vollzogene erste Generierung, die in den vorherigen Abschnitten vollzogen wurde, sowohl die Eigenschaft einer aktiven und passiven und ebenso einer internen und externen Verortung der Distanzierung herausgestellt werden: Als aktive Distanzierung soll dabei die von Eltern bewusst herbeigeführte Abwendung vom Schulgeschehen verstanden werden, passiv bedeutet in diesem Zusammenhang eine als solche empfundene Ausgliederung der Elternbeteiligung seitens der Schule. Als interne Distanzierung wird der Abstand zum Schulleben in der Familie angesehen, während die externe Distanzierung eine direkte Beteiligung in Form von funktioneller Mitwirkung, Kontakt zu LehrerInnen usw. darstellt.
Abb. VII.7: Eigenschaften des Phänomens „Distanzierung vom Schulalltag“
(27)
Auch bei dieser Darstellung wird wieder der unmittelbare Zusammenhang zum Umgang mit Verantwortung deutlich, so dass dieses Konzept als strategischer Weg mit dem Ziel der Distanzierung angesehen werden kann.
Der Verlauf der Generierung des Konzeptes Distanzierung aus dem Datenmaterial wird veranschaulichen, dass die Dimensionen „aktiv“ und „passiv“ oftmals im Einzelfall ineinander übergehen oder gegenseitig bedingen.
a) „Also insofern kann ich ja nur von außen urteilen“
Die Differenzierung von Familie und Schule in ein „Innen“ und „Außen“
Die Wahrnehmung von Familie als „Innen“ und Schule als „Außen“ zeigt sich als häufigste Vorstellung vieler Eltern, wenn sie über den Schulalltag ihrer Kinder berichten. Diese Differenzierung lässt sich sozusagen als Alltagsverständnis der soziologisch fundierten Grundaussage über die sozialen Systeme (?Kapitel II) bezeichnen. Ohne Berücksichtigung dieser wissenschaftlichen Erkenntnis lässt sich die Selbstbeschreibung der Eltern als dominanter Gedanke im Umgang mit Schule beschreiben. Die alltäglich erlebte Präsenz der Kommunikationsprozesse beider Sozialsysteme beeinflusst dabei nicht nur den tatsächlichen Umgang mit dem Schulalltag als familienfremd erlebtes Ereignis, sondern überdies das familiäre Geschehen, indem die Rolle als Vater bzw. als Mutter nicht mehr ausschließlich im Rahmen einer emotional- intimen Beziehung ausgeübt wird, sondern durch die „Doppeladresse“ familiärer und schulbezogener Kommunikation gleichzeitig einbezogen und ausgeschlossen aus dem Schulalltag zu bewältigen ist. Dies bedeutet, dass soziale und kulturelle Elemente aus beiden Sozialsystemen trotz ihrer eindeutigen Differenzierung Berührungspunkte aufweisen.
„Von außen“ als Metapher deutet das Gefühl eines Ausschlusses von Eltern aus dem Schulalltag an, „urteilen“ beschreibt aber gleicher Zeit eine beobachtende Perspektive, die Eltern gegenüber der Schule einnehmen. Die Zweiteilung von Inklusion und Exklusion, die Eltern durch die Unausweichlichkeit mit der Beschäftigung des Schullebens der eigenen Kinder erleben, löst auf einer emotionalen und verantwortungsbewussten Ebene als Vater oder Mutter ein Gefühl der Verzerrung hinsichtlich ihres Erziehungshandelns aus: Mit dem Verzicht auf eine umfassende Teilhabe am schulbezogenen Kommunikationsprozess entsteht gleichermaßen das schlechte Gewissen, das eigene Kind als SchülerIn allein zu lassen. Eine Transformationsleistung, die schulische und familiäre Gegebenheiten innerhalb der Familie auf eine Ebene bringt, lässt sich unter den Umständen der auseinanderklaffenden Inhalte und Beziehungsmuster nicht erreichen.
Die Verwendung der konkreten „Ich kann“-Aussage deutet eine als solche empfundene Einschränkung der Möglichkeiten einer Beteiligung am Schulleben an. Die Schule wird somit als geschlossenes System erlebt, das lediglich eine Beobachterrolle der Eltern zulässt (somit lässt sich auch das systemtheoretisch eingeordnete „verstehende Beobachten“ hier wiederfinden). Die ursächlichen Bedingungen für das Gefühl des Ausschlusses aus dem schulischen Geschehen und die inhaltliche Bedeutung von „kann“ zeigt dabei unterschiedliche Eigenschaften und Dimensionen: So bezieht sich dieses „können“ überwiegend auf den fachlich-kompetenten Bereich – „Die wollten mit dem Lehrplan vorankommen[…]und ich krieg die Krise, ich kann ihr nicht helfen[…]Englisch kann ich ihr nicht großartig helfen“ – oder dem organisatorisch-lenkenden Beteiligungsbereich – „Ja und dann kam das noch mit dem vielen Unterrichtsausfall, wo wir als Eltern ja also gar nichts dran ändern können“ – dem Eltern dann hilflos gegenüber stehen.
b) „Ich bin auch froh[…], wenn das mit der Schule endlich ein Ende hat“
Reflexion des Schulverlaufs als passagere Bewältigungsphase
Die Orientierung der Eltern an einem Lebensereignis, dass sie selbst zwar auch aktiv als SchülerInnen erlebt haben, nun aber aus einer vollkommen anderen Perspektive wahrnehmen und verarbeiten müssen, knüpft direkt an den Gedanken einer vorübergehenden Phase im Leben ihrer Kinder an. Die Umschreibung des subjektiven Empfindens „Ich bin auch froh“ verweist auf die einseitige Elternperspektive im Hinblick auf das Ende der Schullaufbahn und damit die Hoffnung darauf, aus der zugeordneten Doppelrolle als Eltern von SchülerInnen entweichen zu können. Einer Alternativorientierung, die nicht das Ende der Schule, sondern gerade den aktuellen Verlauf zur Freude annimmt, wird keine Bedeutung eingeräumt und so bleibt die Trennung zwischen Familienwelt und Schulwelt weiter bestehen. Die Hoffnung auf das Ende der Schulzeit überlagert dann selbst die Bedenken „wie es weitergeht nach der Schule“, woraus die überdimensionale Belastung durch den Schulalltag deutlich wird.
„Das habe ich jetzt zum größten Teil abgehakt. Ich bin auch froh, muss ich ganz ehrlich sagen, wen das mit der Schule endlich ein Ende hat. Es steht mir hier. Nicht das jetzt die Realschule in K-Stadt das ist. Überhaupt also. Ich bin so wirklich froh, wenn ich mit Schule nichts mehr am Hut habe, weil es immer, immer stressiger wird, also wie soll ich das jetzt sagen. Weil es immer also meiner Meinung nach, also ich bin vom Typ vielleicht auch anders, die Gesellschaft zwingt ja dazu dass du einen bestimmten Abschluss haben musst. Also arbeitest du ja mit deinem Kind dahin, und das ist aber immer so ein Druck auf alle. Auf die Kinder, auf die Eltern, auf alle so ein Druck finde ich. Also dann denke ich immer, das ist ja echt schlimm, also ich empfinde das als ganz schlimm“.
Die ursächlichen Bedingungen, die schließlich zur frohen Erwartung des Endes der Schule führen, zeigen ihre Dimensionen wiederum in der Leistungsgesellschaft, die ihre Ansprüche nicht nur in der Schule verortet, sondern seine Ausläufer in das Familienleben transportiert. Die Weltdeutung, die hier von den Eltern vorgenommen wird, teilt die Lebensbereiche in zwei Teile, wobei der eine (die Familie) anscheinend nur ohne Belastung bestehen kann, wenn der Lebensbereich Schule vorüber ist. Dennoch wird den Ansprüchen von Gesellschaft und Schule nachgegeben, indem darauf hingearbeitet wird, um das zu erreichen, was die Gesellschaft erzwingt.
c) „Da war einfach für mich der Ofen aus“
Die endgültige Abwendung von schulischen Gegebenheiten
Mit dieser Äußerung sind Enttäuschungen verbunden, die sich durch die schulische Struktur im Laufe der Jahre ergeben haben und letztlich zur Abwendung von Schule und ihren Gegebenheiten und Handlungsmustern führen. Die Aussage deutet auf einen Verlauf der Distanzierung zur Schule hin, an dessen Ende, um am gewählten Bild der Interviewpartnerin festzuhalten, das finale Erlöschen des Feuers steht, das ursprünglich gebrannt hat.
Somit kann hinsichtlich der elterlichen Beteiligung am Schulleben der Verlauf hin zur Distanzierung beschrieben werden, dessen Ursache innerhalb der analysierten Fälle nicht im Versagen der Jugendlichen als SchülerInnen beschrieben werden kann, sondern, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen.
Die Entwicklung der wesentlichen Kategorie „Distanzierung“ , die als Konsequenz der zuvor beschriebenen Phänomene anzusehen ist, führt schließlich zur Konstruktion der „anderen Welt“ Der Grundgedanke ist dabei der einer Entwicklung zu der beschriebenen Distanzhaltung von Eltern zur Schule, die sich in den unterschiedlichen Dimensionen aktiv, passiv, extern und intern darstellt (7.4.2), die somit nicht von Beginn der Schulzeit an besteht, sondern durch bestimmte Einflüsse geleitet wird. Dieser prozesshafte Verlauf vom Beteiligungsanspruch der Eltern bis zum Abschied einer zufriedenstellenden Möglichkeit einer schulischen Beteiligung soll im Folgenden anhand von zwei Beispielen verdeutlicht werden:
„Aber ich denke, das ist allgemein so, wenn die Kinder mal ins fünfte Schuljahr gehen, dann wird der Abstand größer als in der Grundschule. Da kann man auch mal wenn irgend etwas ist, dann kann man mit dem Lehrer auch mal sprechen. In den weiterführenden Schulen da haben sie ja montags Deutsch und mittwochs Deutsch oder hat die Fächer, ja, und wenn man dann dienstags Zeit hätte, und dann ist der Lehrer gar nicht da“.
Das Orientierungsmuster an einer Schule, die offen ist für den Austausch mit Lehrern, verliert in den Augen dieser Mutter spätestens nach der Grundschulzeit seine Gültigkeit. Somit hebt sich der Gedanke der gegenseitigen Ergänzung im erzieherischen Handeln im Laufe der Schuljahre durch die Enttäuschung, die Eltern erleben müssen auf. Hinzu kommt eine schulorganisatorische Ebene, die den Abstand zwischen Eltern und Lehrern in der weiterführenden Schule vergrößert und die hier als Indikator für die „Normalität“ dieser zunehmenden Diskrepanz angesehen wird. Obwohl diese Voraussetzungen und damit die Unmöglichkeit einer kontinuierlichen Kontaktherstellung zu den unterrichtenden keine befriedigende Situation darstellt, besteht die Lösung dieses Problems in diesem Falle in einer Akzeptanz der Loslösung von der Schule.
In einem anderen Fall werden die Ursachen der Entfernung vom schulischen Alltag nicht direkt verdeutlicht. Interessant ist aber der beschriebene Bruch, der nach Jahren der intensiven Beteiligung und Beschäftigung mit dem Schulleben des älteren Sohnes mit dem Übergang des jüngeren Sohnes in die weiterführende Schule festzustellen ist:
„Ich habe mich ja schulisch immer mit unserem D-Sohn beschäftigt und habe irgendwann keine Lust mehr gehabt mich schulisch zu beschäftigen mit dem P-Sohn. Also irgendwann wollte ich das nicht mehr und da habe ich zu meinem Mann gesagt, du machst das jetzt und, natürlich lernen, ja also das ganz Normale, also Vokabeln oder, das mache ich auch schon alles, also das schon. Aber ich gehe auf keinen Elternabend mehr, auf keinen Elternsprechtag mehr, also das habe ich jetzt alles an meinen Mann ganz abgegeben, weil ich das mit unserem D-Sohn, ich war ja zwanzig, als der auf die Welt kam, und mein Mann hat studiert und dann war der ja arbeiten und war nur am Wochenende da und da musste ich das alles tun. Und dann habe ich gesagt, nein, also jetzt beim P-Sohn, Grundschule ja, aber wie es dann weiter ging[…]das habe ich zum größten Teil abgehakt“.
In beiden Fällen steht nach einer aktiven und engagierten Beteiligung die Abwendung vom Schulalltag im Vordergrund der Bewältigung dieser Lebensphase. Die Art der Auflösung der motivationalen Rolle der jeweiligen Elternteile unterscheidet sich jedoch erheblich: Während im ersten Fall die von außen aufgedrängte Distanzierung seitens der Schule stattfindet, die in ihrem organisatorischen und strukturellen Gebilde keinen Platz für Eltern vorsieht, zeigt der zweite Fall eine reaktive und bewusste Distanzierung von der Lebenswelt Schule. Dabei wird der Beteiligungsinhalt differenziert, so dass innerhalb der Familie eine notwendige Versorgung des Schülers gegeben ist, alles, was darüber hinausgeht jedoch an den Vater delegiert wird.
Die Enttäuschungen, die motivierte Eltern im Umgang mit Schule erleben, führen letztlich zu einem Spannungsverhältnis zwischen den Lebenswelten Familie und Schule. So befinden sich nicht nur SchülerInnen zwischen diesen beiden Systemen, sondern es sind auch Eltern, die schließlich einem unvereinbaren Konfliktpotential erliegen und im Verlauf von Abgrenzungskämpfen den Rückzug vom Schulgeschehen antreten. So, wie SchülerInnen im Verlauf des Schullebens aus den familiären Gegebenheiten herausgelöst werden, so erfahren auch Eltern diesen Separationsprozess. Somit vollzieht sich die Individuation der Jugendlichen durch die Schule gleichermaßen als Trennung von familiären und schulischen Zusammenhängen. Die Perspektive im Sinne einer Ausdifferenzierung von Familie und Schule mit der entsprechenden Funktionsverschiebung in den Erziehungsleistungen ist sicherlich kein neues Thema, erreicht aber in dieser Arbeit durch die dargestellte Sichtweise von Eltern eine andere Dimension und erweist sich trotz der Akzeptanz der parafamiliären Erziehungsinstanz überwiegend als enttäuschende Situation für Eltern.
Der These das Schule „als das Andere der Familie dadurch immer mehr auch zu einem familiären „Innen“ (Kramer/ Helsper 2000, 207) wird, muss im Rahmen der hier analysierten Fälle widersprochen werden. Die Schule tangiert die Familie zwar aus dem Grunde zunehmend, als sie privilegierte Instanz der Vergabe von unerlässlichen Bildungszertifikaten ist, am Weg dorthin teilzuhaben sehen sich Eltern aber mehr und mehr ausgeschlossen. Die daraus entstehende Differenzierung in zwei Lebenswelten soll im nächsten Konzept verdeutlicht werden.
d) „[…]wie ein Wechsel in eine Andere Welt“
Die Konstruktion der außerfamiliären Lebenswelt Schule
Eltern, die alltäglich und von systemtheoretischer Wissenschaftlichkeit unberührt ihre Gedankengänge äußern, sprechen von einer Trennung der Lebenswelten Familie und Schule, die insbesondere durch eine mangelnde Einbeziehung in den Schulalltag zum Ausdruck kommt. Im familiären Bereich wirkt sich dies aber nicht nur durch die Tatsache des Gefühls der Machtlosigkeit gegenüber schulischen Angelegenheiten aus, sondern ebenso durch das Verhalten der Jugendlichen in der Familie, die durch den täglichen Schulbesuch eine starke Annäherung und Anpassung an das Sozialsystem Schule erfahren haben. Als Teilnehmer beider Systeme verlieren Jugendliche in den Augen ihrer Eltern damit die Möglichkeit, familiäre Werte und Strukturen aufrecht zu erhalten und werden schließlich durch systemspezifische Kommunikationsprozesse zum „Produkt“ der Lebenswelt Schule.
Fehlt die Basis der Zusammengehörigkeit und Zusammenarbeit zwischen Eltern und LehrerInnen, so stellt sich dies als weiterer Faktor dar, das Alltagsleben Jugendlicher in zwei Welten zu differenzieren. Am folgenden Beispiel wird dieser Sachverhalt sehr deutlich, wobei zu Beginn des Interviewausschnittes auch auf die Veränderung nach der Grundschulzeit hingewiesen wird:
„Durch den Wechsel von der S-Grundschule zur Realschule das war also wie ein Wechsel in eine Andere Welt[…]da haben sich die Kinder auch grundlegend verändert […]meine Kinder verhalten sich in der Schule ganz anders als zu Hause. In der Familie kann man miteinander reden und Absprachen treffen, die man in der Regel auch einhält. Bei Lehrern zum Beispiel ist das so, da sagt man was auf dem Elternsprechtag, und der Lehrer macht dann genau was anderes in der Schule. Also nur mal als Beispiel hat mir der Lehrer auf dem Elternsprechtag gesagt, wenn Ihre Tochter ein Problem hat, dann kann sie mich ruhig fragen, dann helfe ich ihr auch weiter, aber in der nächsten Stunde bei ihm dann hat er rumgemeckert, warum die das denn nicht kapieren und so. Das ist ganz anders als in der Familie, weil da kein Miteinander ist, auch bei den Wahlen zum Elternsprecher. Die Eltern kennen sich überhaupt nicht. Ich habe Eltern gewählt, die habe ich noch nie gesehen, die kenne ich gar nicht. So was wie Kleingruppenarbeit das fehlt halt da, wo man sich richtig kennen lernen kann, so was gibt es in der Schule gar nicht. Und die Lehrer die beenden ihre Sprechtag immer Punkt neun, da wird jeder abgefertigt und es kommt gar nicht richtig mal zu einem persönlichen Gespräch wo man dann wirklich mal über Probleme reden kann. Da kommt dann jeder der Reihe nach dran will ich mal sagen, und der Nächste steht schon vor der Tür. Da fehlt halt, na ja, so dass die Kinder sehen, die Eltern und Lehrer arbeiten zusammen, das fehlt halt und das wäre ja mal die Voraussetzung, eine, ja irgendwie eine Verbindung zu schaffen mit der Schule“.
Die Metapher der „anderen Welt“ beschreibt bildhaft die individuelle Perspektive, welche die befragten Eltern als Beobachter und Passivteilnehmer des Schulsystems einnehmen. Die Doppelrolle, die Eltern von SchülerInnen einnehmen, ist gekennzeichnet von einer Paradoxie des sozialen Handelns: Die funktionelle Ebene der Schule mit dem System der Leistungsbeurteilung ist Eltern zwar durchaus bekannt, sie erwarten jedoch im Ablauf des Schulalltags soziale Verhältnisse, wie sie in der Familie gegeben sind – „Das ist ganz anders als in der Familie“. Der einseitige Versuch der Eltern, eine „Verbindung“ zwischen Familie und Schule herzustellen, scheitert.
Der gewählte Ausdruck der „anderen Welt“ beinhaltet somit beides: das Erkennen familienfremder Strukturen und Handlungsweisen im Schulalltag und die bewusste Abgrenzung von der Lebenswelt Schule – „Ich will auch jetzt nichts mehr mit der Schule“ – als Zeichen einer unbefriedigenden Situation, der man aus dem Weg gehen möchte.
Beide Aspekte stellen zentrale Eigenschaften des Phänomens dar. Die „Andere Welt“ steht damit als Ausdruck einer von Eltern vorgenommenen Differenzierung des Lebensalltags, der sich aus den scheinbar unerfüllbaren Ansprüchen des Systems Schule als soziale Lebenswelt ergibt. Die aktive Teilhabe der Eltern an schulbezogenen Kommunikationsprozessen gerät damit auf einer sozial-integralen Ebene in eine Problematik, die durch den organisatorischfunktionalen Anspruch der Schule zu erklären ist.
Durch die folgende Kodierungsübersicht sollen weitere Gesichtspunkte des Phänomens verdeutlicht werden:
Konzept: Die Andere Welt als Ausdruck des bewussten Erkennens familiärer und schulischer Lebensweltdifferenzierung und Distanzierung vom schulischen Lebensalltag
7.3.3 Die „Andere Welt“ als Konstruktion einer System-Umwelt-Differenzierung von Familie und Schule
Nach der ausführlichen Darstellung und empirischen Generierung der Hauptkategorie der Untersuchung, das Verstehen und die aktive Steuerung einer Distanzierung vom schulischen Alltag, ist das Ziel dieses Abschnitts die Bestimmung des integrativen Faktors für alle entwickelten Gesichtspunkte sowie die Integration der Aspekte aus dem bisherigen Analyseprozess um eine Kernkategorie. Die Auswahl und Bestimmung des zentralen Phänomens unterliegt dem Forscher und dient der Verdichtung der Analyseergebnisse um dieses Phänomen, welches zum integrativen Kern der zu generierenden Theorie wird. Die Entscheidung für ein zentrales Phänomen beinhaltet gleicher Zeit den Ausschluss anderer theoretischen Möglichkeiten, die aus den Daten generierbar sind. Dies ist von der Forscherin bei der Entwicklung der Theorie und bei den LeserInnen dieser Arbeit zu berücksichtigen. Das in den Mittelpunkt gestellte und als wichtig erachtete Phänomen wird jedoch als Kernkategorie dieser Untersuchung und dessen theoretische Relevanz für die gesamte empirische Konzeptualisierung und Integration der Daten angesehen.
Das für die Untersuchung als relevant angesehene Phänomen wird anschließend in dem Verfahren des „selektiven Kodierens“ mit anderen Kategorien und Subkategorien in systematisch mittels des Paradigmas in Verbindung gesetzt. So werden Bedingungen, Kontext, Strategien und Konsequenzen herausgearbeitet, die schließlich die Kernkategorie der Untersuchung untermauern. Zudem können weitere Zusammenhänge und Bezüge zwischen den einzelnen Kategorien ausgearbeitet und definiert werden. Die Kernkategorie „muss gewissermaßen die Sonne sein, die in systematisch geordneten Beziehungen zu ihren Planeten steht“ (Strauss/ Corbin 1996, 101).
Aus der Analyse der Elterndaten ließ sich eine im Einzelfall strategisch variierende, jedoch allgemein grundsätzliche Haltung der Eltern hinsichtlich des Umgangs mit dem Schulalltag in der Familie feststellen. Diese lässt erkennen, dass Eltern mit dem Lebensereignis Schule täglich konfrontiert werden und diesem auch und gerade im Familienalltag nicht ausweichen können. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sie dabei zusätzlich zu allen anderen familiären Ereignissen bewältigen müssen, empfinden sie als „Belastung“ und „Enttäuschung“. Wenn zunächst eine offene und positive Haltung gegenüber dem Umgang mit Schule vorhanden war, so zeigt sich durch Reflexion dieser belastenden und enttäuschenden Umstände im Verlauf der Schulzeit eine Abwendung von der Beteiligung am Schulalltag. Diese Distanzierung verläuft überwiegend auf der Grundlage des Umgangs mit Verantwortung, wobei hier unterschiedliche Typen des Verantwortungshandelns existieren (7.2.2). Der Entwicklung einer ablehnenden Haltung, die schließlich über einzelne schulische Ereignisse und Personenkreise hinaus gegenüber der gesamten Institution Schule aufgebaut wird, steht dem Bewusstsein der hochgradigen Bedeutung und Monopolstellung der Schule gegenüber. Die Vorgaben, welche die Gesellschaft macht und die in der Schule und schließlich auch in der Familie ihren Niederschlag finden, werden letztlich zur bedrohenden Macht, der Eltern ausgeliefert sind. Infolgedessen ergibt sich eine Konstellation, die für alle Beteiligten zu einer Situation führt, die befremdlich und ausschließend wirkt: Auf der einen Seite sind Eltern motiviert, zusammen mit der Schule „das Beste“ für ihr Kind zu erreichen und zeigen dem entsprechend auch innerhalb des Familienalltags bezüglich schulischer Anforderungen eine partizipierende unterstützende Haltung, andererseits werden sie aber gerade von der Schule zurückgewiesen, so dass der Eindruck entsteht, sie seien in deren Vorgehen unerwünscht und inkompetent – „Wenn es mal durchaus passiert, dass er in Mathematik in der Schule es nicht versteht, dann haben wir das spätestens am nächsten Tag bei uns zu Hause geklärt[…]und was kriegt das Kind, kriegt in der Schule sofort wieder einen auf den Deckel, weil’s nämlich anders gerechnet wird“. Die Chance und Möglichkeit der Eltern, den Schulalltag ihrer Kinder in der von ihnen erwünschten Weise zu begleiten und in den Familienalltag zu inklusivieren, erleben sie als unmöglich. Je nach dem, wie stark die Differenz vom Anspruch auf schulische Begleitung auf elterlicher Seite und als solche empfundene Ausgrenzung auf schulischer Seite vorherrscht, gestaltet sich der Prozess der Distanzierung zum Schulleben in Form einer enttäuschenden, resignierenden, hinnehmenden Haltung oder in stiller Revolution und Wut.
Dadurch, dass die Möglichkeit einer vollständigen Ablösung vom Schulalltag für Eltern ausgeschlossen ist und die Frage der Ablehnung der Schulpflicht sich nicht stellt, versuchen sie, diesen so weit von sich fern zu halten, als dies für das eigene Kind zumutbar und verantwortbar ist. Die Distanzierung zur „anderen Lebenswelt“ Schule kann somit als Ausdruck einer Schonung der familiären Lebenswelt angesehen werden, wobei die Entscheidung im Handeln der Eltern letztlich sicherlich auch vor dem Hintergrund der zeitlichen Absehbarkeit für die Familie ausfällt. Die eingangs formulierte Frage der Inklusion thematisiert eine solche Prioritätenstellung nicht, sondern geht von dem Schulalltag als normativer Bestandteil im menschlichen Leben aus, wobei die schulbezogene Kommunikation mehr oder weniger selbstverständlich ihren Eingang in die Familie findet und gewissermaßen dort zum Irritationsfaktor der familiären Kommunikation wird. Die Distanzierung zu einer „anderen Welt“ ist somit als reaktive Bewältigungsform der Eltern auf Umstände zurückzuführen, die den Umgang mit dem Schulalltag prägen. Eltern verlagern damit das Problem der Inklusion nicht auf das eigentliche Vorhandensein eines Schulalltages, sondern vielmehr auf das Vorfinden schulischer Tatsachen und Gegebenheiten, die dem elterlichen Denken und Handeln widersprechen und die offensichtlich keinen reibungslosen Eingang in den Familienalltag finden können.
Das Entstehen einer Distanzierung zur „anderen Welt“ Schule kann aber nicht nur – und damit wird der Darstellung der Analyse der SchülerInnenaufsätze bereits vorgegriffen – als Folge der Unzufriedenheit und Enttäuschung der Eltern über schulische Gegebenheiten angesehen werden oder als „Ausschluss“, den die Schule gegenüber den Eltern vollzieht. Es ist ebenso der Höhepunkt individualisierter Lebensverläufe, der bereits im frühen Jugendalter ansetzt und die Familie zu einem von vielen Bereichen der Lebenswelt werden lässt. Die Familie verliert dadurch nicht grundsätzlich ihre spezifische Bedeutung, bedeutet dennoch aber für Jugendliche nicht mehr das Zentrum, sondern muss ihren Platz mit anderen Sozialisationsinstanzen teilen.
Somit geht das zentrale Phänomen der „anderen Lebenswelt“ auch auf einen Ausschluss zurück, den Jugendliche gegenüber ihren Eltern vornehmen, indem sie die Schule als zeitweise wichtigeren Teil ihrer Lebenswelt betrachten (vgl. die Abschnitte 7.5 ff).
Zusammenfassend lassen sich für die von Eltern vorgenommene Konstruktion der „anderen Welt“ die folgenden zentralen Eigenschaften hervorheben:
• Die Distanzierung von der Lebenswelt Schule, die ihre Ursachen in unterschiedlichen Begründungen findet.
• Der fehlende Aspekt der positiven Bereicherung des Familienlebens durch den Schulalltag.
• Die familienfremden Handlungen der Schule hinsichtlich Gerechtigkeit und Orientierung am Jugendlichen als Individuum.
• Der dominante Leistungscode in der Schule.
• Die „verschlossene Tür“ der Schule, die eine Annäherung der einen an die andere im Lebensalltag unmöglich macht.
• Die Entwicklung von Jugendlichen in multiplen Lebensbereichen, durch die der Familie
• als Lebenswelt nur einer von vielen Plätzen zugeordnet wird.
7.3.4 Prozessuale Aspekte zur Konsequenz der elterlichen Distanzierung vom Schulalltag
Wenn in diesem Abschnitt der prozessuale Verlauf der elterlichen Distanzierung zum Schulalltag analysiert wird, so wird dadurch gleichzeitig deutlich, dass von einer ursprünglichen Abwendung der Eltern zum Schulalltag nicht die Rede sein kann. Somit handelt es sich um eine Veränderung im Umgang mit dem Schulleben, die sowohl im Inhalt von Ereignissen als auch in ihrem zeitlichen Verlauf von Fall zu Fall variiert. Zum Konzept der Distanzierung lassen sich jedoch zwei Gegenpole herausstellen, die im Bereich des Anspruchs von Eltern an die Schule und der Realität des schulischen Alltags liegen „das hatten wir uns eigentlich ganz anders vorgestellt“ und die im Verlauf des Schullebens mit der Annäherung an die entscheidende Finalphase der Schulzeit eine Zunahme erfahren. Beide Aspekte wurden bereits inhaltlich durch die ausgearbeiteten Hauptphänomene (insbesondere der Enttäuschungen durch den Schulalltag) in ihren unterschiedlichen Varianten empirisch generiert (7.2.1 ff).
Die Vorstellung vom Schulleben der eigenen Kinder mit der einhergehenden Enttäuschung beruht letztlich auf der Erfahrung, die alle Eltern im Rahmen der eigenen durchlaufenen Schulzeit zurückblicken können – „das war halt bei uns ganz anders“ –, so dass in vielen Fällen von den Elternteilen auch dies als vergleichender Ansatzpunkt verwendet wird.
Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, ereignet sich die Veränderung vom Interesse der intensiven Beteiligung bis zur Distanzierung der Eltern zum Schulalltag insbesondere durch die kontinuierlich erlebten Enttäuschungen mit der Schule. Durch die Konfrontation der Eltern mit der zunehmenden Bedeutung der Schule für die soziale Platzierung ihrer Kinder in der Gesellschaft beginnt bereits eine Loslösung von der Identifizierung mit einem schulischen Lebensalltag, der – wie vielleicht noch die Kindergarten- oder Grundschulzeit – einen bereichernden Charakter aufweist, einmal gekennzeichnet durch den kognitiven und sozialen Wissenszuwachs, den Kinder in der Schule erfahren, zum anderen durch ein Verständnis eines gemeinsamen Erziehungsauftrages von Eltern und LehrerInnen. Mit dem Übergang in die weiterführende Schule bzw. spätestens mit der zunehmenden Zentrierung des Schulalltags auf Schulnoten in den höheren Klassenstufen ändert sich diese positive Erwartungshaltung der Eltern gegenüber der Schule: Der gesellschaftliche Druck, der die Schule als Zielinstitution kontaminiert hat, gerät in den täglichen Ablauf des Familienlebens und löst dort ebenfalls ein neues Verständnis von Schule aus, das jedoch im Widerspruch zu familiären Ansprüchen nicht selbstverständlich hingenommen wird. Die Vorgaben des Bildungswesens verändern somit nicht nur schulinterne Handlung und Kommunikation, sondern verlagern sich auch ins Familienleben. Da hier aber noch weitere, familientypische Belastungen vorliegen (z. B. Berufstätigkeit, Phase der Pubertät, weitere Kinder usw.), wächst der Druck auf Eltern, solchen Anforderungen Stand zu halten.
Teilt man den Verlauf des Prozesses bis zu einer distanzierten Haltung gegenüber dem Schulleben in Verlaufsphasen ein, so lässt sich ein grober Verlauf in drei Phasen feststellen: Die erste Phase der Distanzierung zum Schulalltag ist somit gekennzeichnet durch die Reflexion der bestehenden Differenzen zwischen familiärem und schulischem Wertemuster – „Das ist ganz anders als in der Familie“. Damit ist sicherlich nicht gemeint, dass Eltern vorher nicht um die Unterschiede wussten, die im familiären und schulischen Handeln bestehen. Die Reflexion dieser Unterschiede liegt vielmehr in einer konkreten Vorstellung der Eltern von der Gestaltung des schulischen Organisation und des Umgangs mit SchülerInnen als junge Menschen. Die Erwartungen von Eltern und Schule an das Ziel der Schulzeit sind dabei eng miteinander verbunden, für Eltern hat dieses Ziel jedoch einen sehr individuellen, für die Schule einen universellen und funktionalen Charakter: Eltern wünschen sich für ihr Kind einen möglichst guten Schulabschluss, um so einen optimalen Einstieg in den weiteren Lebensverlauf zu erhalten, die Schule versucht, Jugendliche im Rahmen von Lehrplänen auf dieses Ziel vorzubereiten.
Der Umgang der Eltern mit dieser Differenz gestaltet sich sehr unterschiedlich und kann im Verlauf der ersten Phase der Distanzierung sowohl nach dem Prinzip des direkten außerschulischen Eingriffs in schulische Angelegenheiten verlaufen, wenn diese unzufriedenstellend erscheinen – „insofern bleibt uns als Eltern nichts anderes erspart, als das eben begleitend durchzuführen“ – oder aber in dem Versuch einer kooperativen Teilnahme besonders in Krisenzuständen – „mein Mann ist ja Klassenelternsprecher, und als das war mit dem vielen Unterrichtsausfall, dann hat er auch mal Elternabende gemacht“.
Beide Leistungen zeigen die aktive Auseinandersetzung mit der Lebenswelt Schule und deuten auf den hohen Grad der Übernahme des Stellenwertes schulischer Belange in das Familienleben hin. Mit der Erkenntnis der Differenzen und der damit einher gehenden Einsicht der häufig erlebten Unwirksamkeit des eigenen Handelns jedoch nimmt besonders der Grad der direkten Partizipation am Schulleben ab, so dass man an dieser Stelle die folgende hypothetische Aussage aufstellen kann:
Je deutlicher Eltern die Differenz des Schulalltags zum Familienalltag hinsichtlich eines in der Familie gelebten Humanitätsprinzips erkennen und erleben, desto mehr versuchen sie den Belastungen und dem Druck, der durch die Situation in der Schule entsteht auszuweichen, ohne jedoch dabei die Unterstützung ihrer Kinder direkt zu vernachlässigen.
Das Bestehen einer indirekten Beteiligung, die trotz der Distanzierung weiter bestehen bleibt, wird durch die geäußerten Ängste, Sorgen und Enttäuschen deutlich. Die zentrale Bedeutung der ersten Phase liegt darin, dass negative Erfahrungen in diesem Bereich die ursprünglich offene Bereitschaft der aktiven Teilhabe der Eltern am Schulalltag, die sich in Familie und Schule gestalten kann, die Weichen erstens für die Art und Weise der weiteren Einstellung seitens der Eltern zur Schule stellt und zweitens deren Inhalt und Form der Beteiligung in entscheidender Weise prägt. So ist es nicht der Unterschied allein, der Elternhaus und Schule trennt, es ist vor allem der Umgang mit den Gegebenheiten und der aus Sicht der Eltern zu einer Trennung des Miteinander führt. Vor dem Hintergrund der übermächtigen Bedeutung der Schule – „Alles, was in der Schule läuft, da haben wir ja keinen Einfluss drauf“ – wird die Differenz als gegebene Realität angenommen und der Rückzug aus zumindest direkten Eingriffen in schulisches Geschen realisiert.
Der Prozess der Distanzierung der Eltern vom Schulleben setzt sich in einer zweiten Phase fort, die sozusagen als Gefühl einer Zurückweisung von elterlichen Bemühungen um das Gelingen des Schulalltags in Enttäuschungen mündet – „ich war ja so was von enttäuscht[…]ich dachte, ach du lieber Himmel, was soll das werden“ – und mit solchen Erfahrungen zum Aufgeben weiterer Bestrebungen führt – „dann verliert man ja irgendwie auch die Lust“. Die Erfahrung, vom Schulalltag nicht nur durch fehlendes Fachwissen ausgeschlossen zu sein, sondern ebenso durch das Alltagshandeln als erziehende(r) Mutter oder Vater, veranlasst Eltern, vor allem die aktive Beteiligung einzuschränken und schließlich aufzugeben. So ist diese zweite wesentliche Phase im Allgemeinen gekennzeichnet durch Enttäuschungen und kann als aktiver und passiver Rückzug aus dem schulischen Alltag verstanden werden. Dem Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der Institution Schule folgt die Sorge, dass Jugendlichen durch die universalen schulischen Gegebenheiten zum einen ein Stück Identität verloren geht, zum anderen bleibt aber der universal geprägte Anspruch auf das Bildungsziel auch im Elternhaus bestehen. Die hieraus resultierende Erwartungshaltung der Eltern einer individuellen Förderung und Unterstützung ihrer Kinder wird jedoch enttäuscht und erhöht die Distanz zur Schule, da dem elterlichen Eingriff Grenzen gesetzt werden. Somit scheitern Eltern letztlich an dem Gefühl der Hilf- und Machtlosigkeit und beenden diese Phase mit dem Rückzug einer aktiv orientierten Beteiligungsform. Dieses Zurückziehen resultiert nicht zuletzt auch aus der Tatsache, das Jugendlichen dieser Altersstufe ein selbstständiger Umgang mit ihrem Schulalltag zugetraut und zugemutet wird – „Ich erwarte eigentlich von ihm, dass er selbstständig ist“– und kann somit nicht nur als Negativentwicklung durch die Enttäuschungen mit der Schule, sondern auch als normativer und moderner Entwicklungsverlauf im elterlichen Erziehungsverhalten angesehen werden. Während das elterliche Verhalten und Handeln zu Hause jedoch noch immer und auch im Jugendalter gekennzeichnet ist durch den protektiven Umgang der Eltern mit ihren Kindern, ergibt sich eine Differenz auf Grund elterlicher Ansprüche einerseits und schulischer Realität andererseits. Obwohl diese System-Umwelt-Differenz der sozialen Systeme Familie und Schule im Grunde genommen die Lebensrealität widerspiegelt, können sich Eltern darauf nicht einlassen, da der elterliche Fürsorgegedanke die zugestandene und erzieherisch gelebte Autonomie der Jugendlichen übertrumpft – „sie sind dann eben noch Kinder“.
Während emotional geprägte und fürsorglich ausgerichtete Erziehungsinhalte der Eltern im Wesentlichen weiterhin die Beobachtung des Schulalltags bestimmt, verläuft die dritte Phase bis zu einer weitgehenden der Distanzierung vom Schulleben auf der Basis einer Umverteilung von Verantwortungsinhalten. Im Verlauf der Modernisierung von Erziehungsstilen erweitert sich damit die Übertragung von Verantwortung auf die Jugendlichen über den innerfamiliären Bereich hinaus auf schulische Angelegenheiten. Kinder als SchülerInnen werden dabei von ihren Eltern mit den Ansprüchen der Schul- und Berufswelt konfrontiert und werden dazu herausgefordert, den Weg zu einem gelingenden Ziel selbstverantwortlich zu gehen – „da erwarte ich halt eigentlich schon selbstständiges Schaffen“.
Mit dem Rückzug aus schulischen Angelegenheiten ist auch die Abgabe der Verantwortung an LehrerInnen gekoppelt, die auf Grund der zuvor beschriebenen Enttäuschungen und eines Ausgrenzungsgefühls nun herangezogen werden, die Aufgaben der Schulwelt in angemessener Weise wahrzunehmen. Hier ergibt sich ein Zirkulieren innerhalb des Distanzierungsprozesses, da solche Anforderungen in den Augen der Eltern nur unzureichend erfüllt werden „Aber die Schule grundsätzlich hat für uns einen edukativen Charakter, ganz klar, der in meinen Augen viel zu wenig wahrgenommen wird[…]wo wir zu Hause das fortführen dürfen“ und eine Zunahme der Enttäuschungen herbeiführt. Dennoch bleibt eine weitgehende Abgabe der Verantwortung an die Schule weitgehend bestehen.
Mit einer solchen Verteilungsstrategie, die Eltern hinsichtlich des Schulalltags vornehmen, erfährt der Aspekt der Ausgrenzung eine Erweiterung, die Eltern zwar offensichtlich selbst hervorrufen, die jedoch ebenso als Resultat der oben beschriebenen Ausgrenzung seitens der Schule beschrieben werden kann. Eltern beschäftigen sich in dieser Phase überwiegend dann mit dem Schulleben, wenn sie die Verantwortung auf Grund der Unzuverlässigkeit der Schule selbst übernehmen und somit die Lücken, die Schule im Umgang mit SchülerInnen aus Sicht der Eltern hinterlässt zu schließen versuchen. Egal, welcher Entwurf des Verantwortungshandelns von Eltern gewählt wird, zeigt sich der Umgang mit dem Schulalltag als ein Umgang mit Bedingungen, die nicht im üblichen Verlauf des Familienalltags integriert werden können und einer „besonderen“ Berücksichtigung bedürfen. Mit der Abgrenzungs- bzw. Differenzierungstendenz, die Eltern ganz deutlich auf der Ebene des Verantwortungshandelns zeigen, streben sie eine Befreiung von dem Gefühl der Belastungen und des Drucks an, das sich mit zunehmendem Schulverlauf einstellt. Da eine solche Befreiung jedoch durch die Eingebundenheit als Mutter oder Vater jedoch nicht vollständig gelingen kann, konstruieren Eltern schließlich zwei Welten, um in einem ausreichenden Abstand die Begleitung ihrer Kinder durch die Schulzeit gewähren zu können. Das konstruierte Bild der „anderen Welt“ ist damit ein Produkt, dass die Distanzierung der Lebenswelt Familie von der Lebenswelt Schule erkennen lässt.
Abb. VII.9: Der prozesshafte Verlauf der Distanzierung vom Lebensalltag Schule
7.3.5 „Der rote Faden“ der Elterngeschichte – Eine theoretische Skizze zur Differenzierung der Sozialsysteme Familie und Schule
Die dominanten Kategorien, welche bisher aus der Analysetätigkeit entwickelt werden konnten, sollen nun um die gewählte Kernkategorie der „anderen Welt“ angeordnet und in den systemtheoretischen Kontext integriert werden. Die Identifikation der Kategorien in der Anordnung des paradigmatischen Musters als Bedingungen, Kontext, Strategien und Konsequenzen erfolgte bereits in der Verdichtung jeder Kategorie, die sowohl am empirischen Material als auch losgelöst vom Datenmaterial festgemacht werden konnten (7.4). Durch diese Identifikation können sie im Wesentlichen als Subkategorien mit paradigmatischen Beziehungen eingeordnet werden.
Die Hauptkonzeptualisierungslinie der Daten, der rote Faden der Geschichte, dient der Nachvollziehbarkeit und Transparenz des oben dargestellten Schemas der Hauptkategorien. Das Schreiben der Geschichte stellt für die Forscherin bzw. den Forscher selbst eine effektive Angelegenheit dar, durch die es gelingt, wesentliche, die eigentliche Untersuchungsfrage betreffende Informationen der Daten zu verarbeiten und eine Integration sämtlicher Kategorien zu erreichen. Dabei wird das zentrale Phänomen der Untersuchung in einer beschreibenden Geschichte konzeptualisiert und somit das Wesentliche der Datenanalyse, also Auffälligkeiten, Hauptprobleme usw. identifiziert. Hierbei bilden die zuvor dargestellten Hauptkategorien den Rahmen der Geschichte, das heißt, sie konfigurieren als Bedingungen, Handlungen, Kontext die Integration des Schulalltags, wobei die Konsequenzen im elterlichen Handeln in dieser Geschichte auch das Zentralphänomen charakterisieren.
Der Integrationsprozess, wie er schematisch zuvor dargestellt wurde, verläuft auf einer abstrakteren Ebene als das axiale Kodieren. Es handelt sich hierbei um die Auswahl einer Kernkategorie, die schließlich mit anderen Kategorien in Beziehung gesetzt wird, um hieraus eine – wenngleich vorläufige – Theorie zu entwickeln. Dies geschieht vor dem Hintergrund der bisherigen Analyse, wobei die entwickelten Kategorien und Subkategorien um die gewählte Kernkategorie „Wie eine Andere Welt“ in einen theoretischen Modellentwurf integriert und auf abstrakterer Ebene zusammengefasst werden.
Auf die Schwierigkeit, unter den kategorialen Einordnungen, deren Entwicklung weiter oben beschriebenen wurde, die Kernkategorie als zentrales Phänomen der Geschichte zu finden, wird grundlegend auch von den Autoren hingewiesen (28). Es erschien mir bei dieser selektiven Aufgabe als notwendig und sehr hilfreich, immer wieder zu meiner eigentlichen Fragestellung der Untersuchung zurückzukehren und dadurch weitere bedeutsame Phänomene nicht als zentrale Themen, sondern als Zusammenhang anzusehen. So wäre es zum Beispiel auch interessant gewesen, den Einfluss der eignen Schulzeit von Eltern auf die aktuelle Schulsituation des Kindes zu untersuchen. Das Phänomen „eigene Schulzeit“, dem in vielen Elterninterviews durchaus eine relevante Stellung zugesprochen werden kann, wurde als sekundäres Konzept hinsichtlich der Entscheidung eines weiteren dominanten Themas beibehalten und wirkte als intervenierende Bedingung für den elterlichen Umgang mit dem Schulalltag.
Die folgende Darlegung des roten Fadens identifiziert die Geschichte und damit die Perspektive der Eltern (29) und bezieht sich damit auf eine Untersuchungsgruppe, die – anders als die jugendlichen SchülerInnen – nur indirekt am System Schule beteiligt ist, somit also zunächst in einem passiven Status mit einer Lebenswelt konfrontiert wird, die sie selbst in der aktuellen Situation nicht als aktive TeilnehmerInnen des Systems Schule (als SchülerInnen) erlebt. Die Darlegung des roten Fadens ermöglicht es, die zuvor als wesentlich herausgebildeten Kategorien in einer klaren Art und Weise zu ordnen. Mit der Konzentration auf die grundlegenden Aspekte der Geschichte entsteht schließlich eine logische, analytische Linie des Prozessverlaufs (7.4.4). An dieser Stelle sei noch einmal an die Kernfrage der Untersuchung erinnert, die sich auf die Partizipation der Eltern als Adressaten schulbezogener Kommunikation im Rahmen der familiären Kommunikation bezieht.
Im Anschluss werde ich nun die Geschichte der Eltern in einem beschreibenden Stil darlegen, der sich sehr eng an den entwickelten Kategorien orientiert und den „roten Faden“ dieser Geschichte strukturiert.
Durch die Ermittlung und Entwicklung der beschriebenen zentralen Kategorien Sorgen und Ängste, Umgang mit Verantwortung, Belastungen, Enttäuschungen und Distanzierung handelt die Hauptgeschichte davon, wie Eltern die schulische Situation für ihr Kind aktuell aber vor allem auch hinsichtlich des weiteren Bildungs- oder Ausbildungswegs einschätzen und wie sie selbst das Schulleben auf unterschiedliche Art und Weise zu „bewältigen“ und „begleiten“ versuchen. Der Begriff der Begleitung wird hier verwendet, da er in einer ausführlicheren Weise die Elternbeteiligung am Schulgeschehen beschreibt, wie es der Partizipationsbegriff leisten kann, Bewältigung deutet auf den Umgang mit Belastungen hin, die mit dem Schulalltag zusammenhängen.
Als ursächliche Bedingung für die Entstehung der elterlichen Perspektive, unter welcher der den Schulalltag als eine „Andere Welt“ betrachtet wird, werden Sorgen und Ängste angesehen, die mit der täglichen Konfrontation des Schullebens einhergehen. Egal, ob die schulische Biographie der Kinder in der Vergangenheit oder gegenwärtig „normal“ verlief, d. h. ohne Klassenwiederholung, ohne gravierende Leistungseinbrüche, ohne negative Konfrontationen mit Lehrkräften usw., stellt sie einen erheblich belastenden Faktor im familiären Zusammenleben dar, der einerseits durch Sorgen und Ängste der Eltern bei deren Umgang mit Schule bedingt wird, andererseits solche aber auch hervorruft. Der gesellschaftliche Leistungsanspruch manifestiert sich in der Schule als Bildungsinstitution und gelangt über die aktiven TeilnehmerInnen, die Jugendlichen als SchülerInnen, in den Familienalltag. Mit der bewussten Erkenntnis der Eltern hinsichtlich der Differenzen im familiären und schulischen Handeln leitet sich eine erste Phase der Distanzierung vom schulischen Alltag ein, die besonders dann eine Verstärkung erfährt, wenn keine Möglichkeit gesehen wird, als Eltern Einfluss auf dieses Handeln auszuüben.
Das Bewusstsein über die Unmöglichkeit eines vollständigen Ausweichens aus dieser Situation wird zum Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Schule: Der Schulalltag, unterscheidet sich aber vom Familienalltag nicht nur in funktioneller Hinsicht und ist in der Familie täglich präsent. Eine „Ablehnung“ der Eltern dieses familienfremden Alltags ist aber unmöglich. Eingebunden in den Schulalltag fühlen sich Eltern einer täglichen, belastenden Auseinandersetzung mit den Schulangelegenheiten ihrer Kinder ausgesetzt, wobei es durch das eben beschriebene ohnmächtige Gefühl gegenüber schulischem Handeln und der Pflicht, im Rahmen des familiär- emotionalen und verantwortungsbewussten Handelns sowie der elterlichen Sorge am Schulleben teilzunehmen zu einem Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Positionen kommt. Als eine Antwort auf diesen Spannungszustand entsteht bei Eltern das Gefühl der Belastung, welche die Bewältigung der Anforderungen und Probleme, die der Schulbesuch ihrer Kinder mit sich bringt, bezeichnet. In einem Rahmen von Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung am Schulalltag fällt es Eltern schwer, den richtigen Grad der Verantwortung zu finden: Einerseits soll das in allen Fällen vorgefundene familiär erwünschte Erziehungsziel der Selbstständigkeit des Heranwachsenden beibehalten werden, andererseits stellt sich die schulische Situation oft so unbefriedigend oder gar befremdend dar, dass Eltern über eine Unterstützung hinaus eine kontrollierende Haltung einnehmen oder die Verantwortung in die Hände der LehrerInnen oder der Jugendlichen selbst abgeben.
Die strategische Bewältigung der unproblematischen wie problematischen Schulkarriere des Kindes erfolgt dabei auf unterschiedlichen Ebenen, wobei auch der Umgang mit den von den Eltern wahrgenommenen Schwierigkeiten variiert. Sie entwickeln entsprechende Strategien, um
• ihren Kindern eine angemessene Voraussetzung für die weitere Bildungs-, Berufs- und Lebensbiographie zu ermöglichen,
• die Schullaufbahn an der Seite ihrer Kindern zu unterstützen,
• ihren Kindern einen größtmöglichen Raum autonomer Entwicklung zu gewährleisten,
• einen für sich selbst notwendigen emotionalen Abstand zur Schule zu gewinnen.
Die Konzeption einer möglichst erfolgreichen Bewältigung des Schulverlaufes der eigenen Kinder kann sich dabei sowohl durch die Verantwortungsübernahme seitens der Eltern zeigen (Informationsbereitschaft und aktive Handlung im Schulalltag), oder den Rückzug der Eltern aus der Verantwortung für das Schulleben aufweisen, was eine Übertragung der Verantwortung auf alle übrigen Beteiligten zur Folge hat: auf das Kind selbst, dessen LehrerInnen oder allgemeiner der eher anonymen Institution Schule. Die Differenzierung, die sich hier zwischen „aktivem“ bzw. „passivem“ Elternhandeln auftut, sollte jedoch nicht als eine grundsätzliche Unterscheidung verstanden werden, die in jedem Fall andere Ursachen hinsichtlich der familiären Motivation aufweist. Es hat sich vielmehr herausgestellt, dass jede Form des Umgangs mit Verantwortung als ein Schutzmechanismus verwendet wird, um Belastungen möglichst zu vermeiden, die notwendige Teilhabe am Schulgeschehen aber zu gewährleisten. Eltern weisen somit eine Zwiespältigkeit im Handlungszusammenhang der Verantwortungsübernahme bzw. Delegierung von Verantwortung auf, hervorgerufen durch das belastende Erleben des Schulalltags.
Strategien, die von Eltern im Umgang mit Verantwortung angewandt werden, sind von Fall zu Fall verschieden. Während in der einen Familie der Zugang zur Schule verstärkt gesucht wird, z. B. durch direkte Partizipation in Form von Übernahme organisatorischer Funktionen, Gespräche mit LehrerInnen usw., erfolgt im anderen Falle die Ablehnung solcher schulischen Strukturen, die sich dem Familienleben und den hier vermittelten Werten zu sehr entgegenstellen. Dieses Exklusionsverhalten äußert sich wiederum in Form einer ausgeprägten Verantwortungsübertragung an Jugendliche und Schule, einem direkten Beteiligungsentzug oder einer defensiven Haltung gegenüber schulischen Handlungen.
Die dargestellte Variation in den Bewältigungsprozessen muss nicht automatisch zu einer strikten Differenzierung in den unterschiedlichen Fällen führen. Vielmehr kann es durchaus sein, dass alle erwähnten (und weitere) Strategien zum Tragen kommen, um ein und dasselbe Ziel zu erreichen: zu Ängsten, Belastungen und Enttäuschungen einen Abstand zu gewinnen oder sie in mehr offensiver Haltung anzugehen. Das jeweils angestrebte Ziel setzt somit die Konsequenzen der Eltern in Kraft und scheint sich primär auf eine Bewältigung der aktuellen Schulsituation und die nachschulische Zukunft der jungen Menschen zu richten, wodurch der nach Hause gebrachte Schulalltag als Prozess angesehen wird, dessen Ende absehbar ist und offenbar rasch herbeigewünscht wird (30).
Als ein weiteres Hindernis, den Schulalltag als ein willkommenes Ereignis in den Familienalltag aufzunehmen, scheinen sich Enttäuschungen in den Weg zu stellen. Die Genese von Enttäuschungen, die damit als intervenierende Bedingungen eine Verstärkung der ursächlichen Bedingungen darstellen, ist von Fall zu Fall dabei ebenso unterschiedlich, wie deren Ausprägung und der tatsächliche Einfluss der Eltern auf den aktuellen Bewältigungsprozess des Schullebens der Kinder. Enttäuschungen lassen sich auf zwar grundsätzlich auch auf schulorganisatorische Ursachen zurückführen, dahinter stehen aber für die Mehrheit der Eltern Bedenken, ihr Kind könne durch solche Ursachen Nachteile im weiteren Bildungs- bzw. Ausbildungsverlauf erhalten. Ganz deutlich wird auch die Bedeutung der Betreuung des eigenen Kindes in der Schule auf emotionaler Basis, die von Eltern durch den ausgeprägten Leistungsgedanken von Schule und anderen Eltern, Unterrichtsausfall usw. als überwiegend nicht ausreichend angesehen wird.
Eltern beobachten und überwachen nicht nur den Schulalltag ihrer Kinder, sie zeigen sich auch emotional beteiligt an Erfolgen und Niederlagen und fällen bei Bedarf weitgreifende Entscheidungen, etwa ob sie selbst oder ihre Kinder die weiterführende Schulart oder Ausbildung bestimmen, ob bei bestimmten schulischen Konflikten aktiver Eingriff (z. B. das Aufsuchen des Lehrers) notwendig ist, oder ob bezüglich der schulischen Leistungen eingegriffen werden muss. Sie ermitteln dabei jeweils, ob die Strategie von familiärer Seite geklärt werden kann, oder ein direkter Kontakt mit der Schule hergestellt werden muss. Weiterhin zeigen alle zur Analyse herangezogenen Interviews, dass Eltern durchaus die Konfrontation mit fachlichpädagogischen und lehr-, bzw. lerntechnischen Anweisungen der Lehrer suchen, wenn sie der Annahme sind, dass der Erfolg und das Wohlergehen ihrer Kinder von schulischer Seite aus gefährdet sind.
Vor diesem spannungsreichen Bewältigungshintergrund der schulischen Lebenswelt entstehen innerhalb des Familienalltags zentrale Themen, die aus den Gegebenheiten der jeweiligen Bewältigungskrise resultieren. Die Kontroverse, den Schulalltag mit seinen außerfamiliären und belastenden Anteilen einerseits und der Tatsache der direkten Eingebundenheit in diese Strukturen andererseits zum Bestandteil des Familienalltags zu machen, führt bei Eltern zu unterschiedlichen Handlungsformen im Umgang mit dem Schulalltag. Eine affirmative Haltung, welche durch Inklusion der nach Hause gebrachten schulbezogenen Kommunikation als parafamiliären Lebensalltag aufnimmt, lässt sich für keinen der analysierten Fälle feststellen. Vielmehr scheint es, als entwickeln Eltern Strategien, die nötige Eingebundenheit in schulische Angelegenheiten zum Schutz ihrer Kinder aufrecht zu erhalten, gleichzeitig jedoch nehmen sie einen notwendigen Abstand ein, um sich selbst vor den entstehenden Belastungen zu schützen. Die Folge dieser Abkopplungspraxis zeigt sich in der Konzeption einer elterlichen Distanzierung vom Schulgeschehen, die auffällig und ungleich höher ist, als dies im Vergleich zu anderen Entwicklungs- bzw. Sozialisationsmomenten mit denen Eltern in Phasen der Kindheit und Jugend konfrontiert werden der Fall ist. Die Anforderungen und Ereignisse des Schullebens der weiterführenden Schule werden innerhalb der Familie weniger als Bereicherung, z. B. durch einen sozialen und kognitiven Wissenszuwachs im Entwicklungsverlauf Jugendlicher angesehen, wie es noch vergleichsweise ausgeprägt in der Kindergarten- oder Grundschulzeit geschieht. Die Form der Distanzierung gestaltet sich auf unterschiedliche Weise, in jedem Fall jedoch spielt die Bedeutung der Schule als Institution der Vergabe von Bildungszertifikaten eine große Rolle: Distanzierung ist einmal die hinnehmende Haltung der Differenzen von Familie und Schule, ohne jedoch Akzeptanz zu sein, ein andermal der revolutionäre Aufstand gegen die Schule, der familienintern zum Tragen kommt, oder allenfalls im Gespräch mit LehrerInnen oder Schulleitung endet.
Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, auch solche Fälle zu finden, in denen die Familie direkt und ohne die immense Leistungs- und Erfolgserwartung von der guten Beziehung der Kinder zu ihren Lehrern berichtet oder die sozialisatorischen und bildenden Schulereignissen als unterstützende Ereignissen ansieht, von denen auch Eltern profitieren können. Von einer solchen anerkennenden und positiven Haltung zum Schulalltag kann innerhalb der durchgeführten Untersuchung dieser Arbeit nicht berichtet werden. Hier könnte eine Vergleichsuntersuchung mit alternativen Schularten, die SchülerInnen mehr als Mensch mit seinen Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen (zum Beispiel mit Eltern von Waldorf- SchülerInnen) eine bereichernde Variante darstellen.
Zusammenfassend kann für die Geschichte der Eltern nun folgendes festgestellt werden: Wie sehr der Schulalltag das Familienleben belastet, hängt von den unterschiedlichen Eigenschaften der Lebensumwelt von Eltern und SchülerInnen ab. Hierzu gehören primär sowohl die individuellen Erfahrungen, die Mütter und Väter in der eigenen Schulzeit machen konnten, wie auch die aktuellen Möglichkeiten, das eigene Kind hinreichend zu unterstützen oder die Tatsache, wie selbstständig Jugendliche mit der Bewältigung ihres Schulalltags umgehen, wie sie Erfolge und Niederlagen autonom verarbeiten können.
Weiterhin unterliegt die Verarbeitung schulischer Prozesse innerhalb der Familie der zentralen Bedeutung, die Schule für die weitere Biographie des Jugendlichen hat. Diese Weichenstellung als Zentrum schulischer Bildung und Sozialisation, direkt gekennzeichnet durch eine entsprechende Zertifizierung, die als „Eintrittskarte“ für alle weiteren Bildungs- oder Ausbildungsgang angesehen werden kann, trägt, wie die Studie gezeigt hat, in entscheidender Weise zum familiären Umgang mit dem Schulleben bei. Generell zeichnet sich zwar die Tendenz einer Distanzierung zum Umgang mit dem Schulalltag ab, eine Abwendung vom Thema „Schule“ kann jedoch keinesfalls festgestellt werden.
Als primäres Thema der Elterngeschichte wird Distanzierung vom Schulleben angesehen, das von Eltern als Andere Welt beschrieben wird. Um den restlichen Schulverlauf mit den belastenden Umständen, die damit verbunden sind, gemeinsam zu überstehen, versuchen Eltern den direkten Kontakt mit dem Schulleben weitgehend von sich abzuwenden, ohne jedoch den Schulalltag aus der Familie ausschließen zu können.
Der Grund für den Entschluss, die Kategorie Distanzierung und das damit verbundene Zentralphänomen der Schule als „Andere Welt“ in den Mittelpunkt zu stellen ergab sich aus einer permanenten Verdeutlichung dieses Aspektes in allen Elterninterviews. Jedes Elternteil betonte neben dem Wunsch auf einen möglichst guten und höherwertigen Schulabschlusses und einer Einbettung des eigenen Kindes in ein mehr individuell orientiertes Schulleben die Hoffnung, dass das eigene Kind mit den schulischen Anforderungen und Gegebenheiten möglichst alleine zurecht kommt und eine Beteiligung am Schulalltag seitens der Eltern nicht nötig ist.
7.4 Die Analyse der Aufsätze von jugendlichen SchülerInnen:
Der Schulalltag im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher
Von größter Bedeutung für die sich anschließende Analyse der Aufsätze (31) von SchülerInnen ist die Konfiguration der sozialen Einbettung in der Schule. Im theoretischen Teil über die zunehmende Prägnanz der Schule für die Lebensphase Jugend und der hiermit verbundenen Entwicklung eines hohen Autonomiegrades (vgl. insbesondere Kapitel 3 und 4) konnte bereits ein erster Eindruck hinsichtlich der zunehmenden Tragweite des Bildungssystems, aber auch der Schule als Ort der Persönlichkeitsentwicklung Heranwachsender gegeben werden.
Der Wandel in den (Generationen-)Verhältnissen, der sich primär zwischen Eltern und Jugend darstellt, aber auch im Beziehungsmuster schulische Personenverhältnisse Einzug gehalten hat, zeigt sich auch im analytischen Rahmen der Aufsätze von jugendlichen SchülerInnen: Das autonome Handeln und die Möglichkeit freier und eigener Entscheidungen und Realitätskonstruktionen wird für den Bereich des Umgangs mit Schule in besonderer Weise relevant. Somit ergibt sich auch für den Stellenwert, den Schule im Leben eines jungen Erwachsenen einnimmt ein Perspektivenwechsel, wobei die Schule trotz ihrer Monopolstellung für die Vergabe der grundlegenden Bildungszertifikate nur noch eine von vielen Lebenswelten ist, in der Jugendliche aufwachsen.
Die Bedeutung, die Jugendliche der Schule anmessen, basiert aber nicht nur auf Lerninhalten und Leistungserbringung, sondern auf einer Schule als dem Ort, der in einer umfassenden Art die Möglichkeit der Kommunikation mit Gleichaltrigen bietet.
Die von Eltern und SchülerInnen vorgenommene Konstruktion des Lebensalltags Schule, der schließlich in den Familienalltag Eingang findet, zeigt sich allein schon durch die unterschiedliche Bedeutungszumessung von Eltern und ihren Kindern – „dass der Lehrer und die Institution Schule nur betrachtet werden von den Schülern, nur betrachtet werden als tägliche Aufgabe, während sie für uns natürlich einen wesentlich höheren Stellenwert zugemessen bekommt“ – woraus sich auch der tägliche Umgang mit dem Schulalltag innerhalb der Familie eher kontrovers gestaltet. So ist die Einordnung des Schulalltags, die von Eltern vorgenommen wird, die der Schule als „Ernst des Lebens“, SchülerInnen hingegen sehen über die Leistungsanstrengung hinaus Schule als Ort der Begegnung mit Gleichaltrigen an.
Bei der Analyse der SchülerInnendaten geht es im Folgenden ausschließlich – was letztlich auch auf die vorgegebenen Aufsatzthemen zurückzuführen ist – schwerpunktmäßig um die Frage, wie sehr Eltern den Lebensalltag Schule miterleben und mitbestimmen. Wie bei der Analyse der Elterndaten konzentriert sich die Untersuchung nicht auf die Leistungserwartung der Schule und die Leistungsmotivation von SchülerInnen, sondern an der Frage, wie viel Beteiligung und Teilhabe der Eltern bei SchülerInnen erwünscht oder verlangt, und damit ebenso, sie sich Familien- und Schulalltag überschneiden sollen. Es kann aber an dieser Stelle bereits vorab gesagt werden, dass Schulleistungen (in Form von Noten) und das Thema „Hausaufgaben“ im Vordergrund der Aussagen der SchülerInnen stehen. Diese Fokussierung erreicht damit eine Übereinstimmung der von Eltern in den Mittelpunkt gestellten schulthematischen Ereignisse.
7.5 Der Umgang mit dem Schulleben in der Familie aus Sicht der SchülerInnen
Es wurde bereits auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die im Rahmen der Datenerhebung in der Gruppe der SchülerInnen entstanden sind (Kapitel 6). Die alternativ durchgeführte Methode, Aufsätze zu vorgegebenen Themen schreiben zu lassen, konnte zwar das Resultat ergiebigeren Materials erreichen, hat aber gleichzeitig zu einer Einschränkung hinsichtlich der Erschließung des Themas jugendlicher Lebenswelten geführt. Es fehlt somit vor allem die Basis empirischen Materials, wo SchülerInnen umfassend und diskursiv auf den Zusammenhang der Lebenswelten Familie und Schule eingehen konnten. Aus diesem Grunde bewegen sich die folgende Interpretation des Aufsatzmaterials der SchülerInnen auf einem eher riskanten Niveau und bedürfen zur Erzielung eines weitreichenderen Effektes einem umfangreicheren empirischen und theoretischen Aufwand.
Wenn nun in diesem Abschnitt die Reflexion im Umgang mit dem Schulalltag zu Hause aus Sicht der SchülerInnen kontrastiert werden soll, dann muss weiterhin darauf hingewiesen werden, dass die Präsentationen der SchülerInnen zu dem vorgegebenen Aussagematerial (6.5.2) teilweise durch ihren Inhalt ebenfalls einen gewissen Rahmen vorgeben, in dem nur minimale Hypothesen formuliert werden können. Andererseits haben sich innerhalb der Analyse der vorab ermittelten Aussagen der Pilotbefragung von SchülerInnen solche elterlichen Handlungsmodelle herausgestellt, die sich sehr gut im Rahmen einer komparativen Analyse zu den zentralen Aspekten der Elterninterviews verwenden lassen. Zur Erinnerung: Es waren dies Umgang mit Verantwortung, Sorge und emotionale Verbundenheit und Fürsorge und Erziehung zur Autonomie auf Seiten der Pretest-SchülerInnen (6.5.2) und die Hauptkategorien Sorgen und Ängste, Umgang mit Verantwortung, Belastungen, Enttäuschungen und Distanzierung vom Schulleben auf der Elternseite (7.2 ff).
Vor dem Hintergrund dieser Einschränkungen und Möglichkeiten sollen nun die Aufsätze der zur Untersuchung herangezogene Gruppe der SchülerInnen hinsichtlich der oben bezeichneten Hauptkategorien analysiert werden. Dies bietet einerseits den Vorteil eines direkten Eltern- SchülerInnen-Vergleichs, zum anderen werden durch die weitgehende Übereinstimmung der Hauptkategorien von Eltern und Jugendlichen keine wesentlichen Aspekte der SchülerInnenaussagen vernachlässigt.
Aus Platzgründen und um eine Wiederholung hinsichtlich methodisch-technischer Exemplifizierung zu vermeiden, wird darauf verzichtet, das Vorgehen der Analyse in der arbeitstechnisch aufgeteilten Ausführlichkeit darzustellen, wie dies für die Auswertung der Elterninterviews getan wurde. Auf wesentliche Aspekte kann dabei selbstverständlich nicht verzichtet werden. Überwiegend werde ich jedoch gezielt auf die zuvor genannten Kategorien eingehen und im empirischen Datenmaterial der SchülerInnenaufsätze nach Ausprägungen dieser Kategorien suchen. So können nicht nur Vorstellungen und Wünsche hinsichtlich des elterlichen Umgangs mit dem Schulalltag festgestellt, sondern auch Abweichungen gegenüber der Elternaussagen verdeutlicht werden.
Die Analyse der Aufsätze von SchülerInnen soll nun in zwei Schritten vollzogen werden:
1) Zunächst wird eine Untersuchung aller vorhanden Aufsätze vorgenommen, wobei der Vorgang des theoretischen Samplings (?6.4) im Falle der SchülerInnendaten umgangen wird. Dafür wird insbesondere nach Übereinstimmungen hinsichtlich der innerhalb der Elterndaten generierten zentralen Kategorien gesucht.
2) Nach dieser allgemeinen Auswertung erfolgt dann eine Verbindung der generierten Phänomene mit allgemeinen entwicklungspsychologischen Thesen zur Entwicklung des Individuums in der Lebensphase Jugend.
Nach ausgiebiger Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, auf eine Gegenüberstellung der Fälle, in denen sowohl das Interview eines Elternteils als auch der Aufsatz dessen Kindes vorliegt, zu verzichten. Die Begründung für diese Entscheidung liegt letztlich darin, dass ein spezifischer Eltern-Kind-Vergleich keine weitere Bereicherung zur Entwicklung bzw. Validierung der generierten Theorie bieten kann. Es wäre eine weitere und umfangreichere Datenerhebung erforderlich, um diesen durchaus interessanten Vergleichsaspekt näher zu beleuchten.
Für die erste Variante wird zunächst authentisches Material zur Belegung des zentralen Phänomens geordnet, um anschließend die wesentlichen Konzepte, die sich aus dem empirischen Material ergeben haben mit ihren Eigenschaften im Rahmen einer Kodierungsübersicht zu erarbeiten.
Die Darstellung der Auswertungsergebnisse beginnt mit einer komparativen Vergleichsanalyse des zentralen Phänomens „Umgang mit Verantwortung“, das sich bereits in den Elterninterviews als vorherrschendes Thema herausstellte und im Rahmen der Aufsätze von SchülerInnen als Zeichen der Abgrenzung von unterschiedlichen Lebenswelten in den Mittelpunkt der Darstellungen gerät. Weitere zentrale Kategorien, die ebenfalls eine komparative Ausrichtung hinsichtlich der sich im Eltern und SchülerInnen-Vergleich erfahren, da sie für beide Bereiche einen wesentlichen Charakter aufweisen, sind „Unterstützung“ und schließlich als Hauptphänomen die „eigene Lebenswelt Schule“.
Im nächsten Abschnitt wird bereits eine deutliche Annäherung an die von SchülerInnen entwickelte Perspektive hinsichtlich der Bildung einer für Jugendliche wesentlichen Umwelt angezeigt, die schließlich durch die Zentralkategorien validiert werden kann.
7.5.1 Schule als Lebenswelt jugendlicher SchülerInnen
Mit der Verarbeitung der in der Jugendphase wesentlichen Lebenswelten Familie und Schule gelingt es Jugendlichen, im Verlauf der Schulzeit der weiterführenden Schule eine relativ klare Differenzierung vorzunehmen, wie dies in der Grundschulzeit (32) noch nicht festgestellt werden kann. So kann davon ausgegangen werden, dass der Schulalltag in der Grundschule zunächst als fremd erscheint, da sich der Sozialisationsprozesses in der Schule von Beginn an durch die Aufgaben, die Schule stellt, von der familiären Sozialisation unterscheidet. In der Familie streben Kinder danach, sich mit den Eltern zu identifizieren und verinnerlichen deren Rollenerwartung. Da der Schulalltag sowohl hinsichtlich der Erwartungen als auch das Verhältnis zu den hier agierenden Autoritätspersonen der gewohnten familiären Einbettung dem Schulkind der ersten Klassenstufen als fremd erscheint, ist das Gefühl der Sicherheit durch die Eltern an der Seite des Kindes für die Bewältigung des Schulalltags von großer Bedeutung – „In den Klassen vom 1. Schuljahr bis zum 4. sollten die Eltern aber jeden Tag nach der Schule fragen“.
Dieser kleine Exkurs zum Umgang von Kindern mit der Schule als Lebenswelt während der Grundschulzeit verdeutlicht den Wandel, der sich bis zum Ende der weiterführenden Schullaufbahn einstellt. Vermutlich ist dieser auf zwei Ursachen zurückzuführen: Zum einen gelingt es SchülerInnen, im Verlauf der Konfrontation mit dem Schulalltag und den damit verbundenen Aufgaben eine Identifikation mit den Wertvorstellungen der Schule und der hier agierenden LehrerInnen zu erreichen und dadurch bereits eine gewisse Selbstständigkeit im Umgang mit dem Schulalltag zu entwickeln. Im Rahmen dieser Entwicklung entsteht das Bild der Eingebundenheit in mehrere soziale Systeme, so dass die Schule für Jugendliche schließlich die Bedeutung als „meine Schule“ erhält, was auf eine Identifizierung mit dieser Lebenswelt und eine deutliche Abgrenzung zur Lebenswelt Familie verweist.
Ein weiterer Grund hängt mit dieser Entwicklung zusammen, wird aber noch verstärkt durch Veränderungen, wie sie moderne Erziehungsstile des Verhandlungshaushalts (3.8 ff) mit sich bringen. So trägt die Erziehung zur Selbstständigkeit bei Jugendlichen in erheblicher Weise dazu bei, dass Jugendliche sich in vielen verschiedenen sozialen Bezugssystemen auch ohne ausgeprägte Koordinationshilfen ihrer Eltern bewegen können. Sie folgen damit einer gesellschaftlichen Entwicklung der hochgradigen Differenzierung von Lebensweltbezügen.
Dies wird auch durch die Analyse des empirischen Datenmaterials der SchülerInnen deutlich, dass in quantitativer Hinsicht zwar eher sparsame Äußerungen aufweist, inhaltlich aber eine eindeutige Tendenz im (gewünschten) Umgang mit dem Schulalltag zu Hause verdeutlicht, wobei es keinen signifikanten Unterschied zwischen den befragten Jungen Mädchen erkennen lässt.
Trotz der Tendenz der Entwicklung der Schule als eine dominante und „eigene“ Lebenswelt, bestätigt die Analyse des empirischen Material der SchülerInnen, den Wunsch jugendlicher SchülerInnen, die Familie im Hintergrund schulischen Geschehens als Garant der Unterstützung zu erhalten – „Ich denke, die ideale Lösung ist, dass Eltern sich dann in das Schulische einmischen, wenn ihre Kinder sie brauchen“, – um die institutionellen Rahmenbedingungen bewältigen zu können. Differenzen von Familie und Schule werden SchülerInnen unter anderem dann bewusst, wenn Anforderungen des Schulsystems und Möglichkeiten der Eltern hinsichtlich der Unterstützung nicht übereinstimmen – „Meine Mutter kann mir zum Beispiel in Mathe und Englisch nicht helfen. Trotzdem regt sie sich darüber auf, dass ich so schlecht in diesen Fächern bin“, – so dass sie sich gezwungen sehen, eigens Verantwortung für „ihre Schule“ zu tragen.
Ganz deutlich wird dennoch auch das selbst gewünschte Autonomiestreben der SchülerInnen zu diesem Zeitpunkt ihrer Schullaufbahn. So kann im Rahmen des zur Verfügung stehenden Datenmaterials von einem Konsens der „freiwilligen“ Verantwortungsübernahme der Jugendlichen ausgegangen werden. Durch die Einbeziehung einer entwicklungspsychologischen Darstellung im Ablauf von Lebensphasen vollzieht sich innerhalb der sozialen Reife eines Menschen die Fähigkeit, soziale Beziehungen eingehen und eigene Fähigkeiten einschätzen zu können. Damit wird der Schulalltag zum Handlungsfeld Jugendlicher, mit dem sie inhaltlich sogar besser vertraut sind, als ihre Eltern (wie durch das obige Beispiel der Aussage einer Schülerin gezeigt hat).
Im Gegensatz zu der innerhalb der Elterninterviews hervortretenden Kategorie der „Distanzierung“ vom Schulleben kann bei den beteiligten RealschülerInnen somit sogar von einer deutlichen Annäherung an diese Lebenswelt gesprochen werden. Die Ursache hierfür liegt sicherlich nicht an den grundsätzlichen schulischen Inhalten und Ansprüchen, sondern vielmehr an der Tatsache, dass die Schule und der damit zusammenhängende Lebensalltag das organisierte Zusammenkommen von Gleichaltrigen in einer Weise impliziert, wie es keine andere Institution leisten kann. So wird die Schulalltag zum alltäglichen „sozialen Erlebnis“ und ermöglicht in umfassender Weise den jugendkulturellen Austausch.
7.5.2 „Die Schule ist die Sache der SchülerInnen“
Die Übernahme eines eigenen lebensweltlichen Bereiches
Dass Jugendliche Schule als „ihr“ Handlungsfeld ansehen, ist auf die Konfrontation mit dem Schulleben über viele Schuljahre zurückzuführen. Die Schule ist zu einem sozialen Handlungsfeld geworden, in dem Heranwachsende eine Orientierung gefunden haben, die es ihnen erlaubt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ohne ihre Eltern auszukommen. Soziale Interessen und Fähigkeiten stehen innerhalb dieser eigenverantwortlichen Position ebenso im Vordergrund wie sozio-kognitive Kompetenzen. Die eigenverantwortliche Position wird im Laufe der Schuljahre durch die Sicherheit im Umgang mit Anforderungen des schulischen Alltags und durch eine allgemein erreichte Selbstständigkeit geprägt. Die schulische Verortung wird dann nicht mehr als Herauslösung aus der Familie empfunden, sondern als Bereicherung um einen autonom bestimmten Handlungsbereich, welcher die ganzheitliche Förderung zur Selbstständigkeit des jungen Menschen betrifft – In der Schule lernt man nicht nur Mathe, Englisch …, sondern auch, sich ein Ziel zu setzen und es zu erreichen[…].Das Kind lernt, auf eigenen Beinen zu stehen“ – und damit auch eine Loslösung vom Elternhaus einleitet.
Die sozialisatorische und entwicklungspsychologische Relevanz dieses Sachverhalts ist für den Entwurf einer eigenen Lebenswelt Schule von enormer Bedeutung. So zeigen sich als Form eines prozesshaften Verlaufs im Umgang mit Schule Veränderungen, die ihre Ursache im biographischen Wandel von der Kindheit in die Jugendphase haben. Dem hier dokumentierten Aspekt des Umgangs mit Schule kann einem qualitativen Umdenken hinsichtlich schulischer Anforderungen und Ereignisse entsprechen. Die Entdeckung, dass die Konfrontation mit dem Schulalltag eigene Grenzen und Möglichkeiten aufzeigt, verändert bei Jugendlichen auch den Umgang mit den elterlichen Vorstellungen – „Man kann den Eltern nicht immer alles recht machen“ – und führt zur Forderung – Dem Schüler eine gewisse Verantwortung für seine Schule zu übertragen“. Der Hinweis „gewisse“ lässt den von Eltern- und SchülerInnenseite wichtigen Aspekt hervortreten, der auf die bei der Analyse der Elterndaten vorgenommene Bezeichnung des „bedarfsorientierten Verantwortungshandelns“ (7.2.2) hinweist und damit „zwischen Verantwortung und Desinteresse unterscheidet“.
Wie bei den Eltern lässt sich also auch bei SchülerInnen keine vollständige des einen von dem anderen Lebensalltag herstellen. Vielmehr findet auf dem Boden des Bestrebens einer selbstständigen Bewältigung des Schulalltags gleichzeitig ein Kompromissversuch zwischen Familien- und Schulleben statt – „Ich meine, ab und zu sollten Eltern richtig mit ihrem Kind sprechen und fragen, wie es in der Schule so klappt. Die meisten Schüler/innen werden sich aber selbst darum kümmern, dass sie es den Eltern sagen“.
Der umfassende Weg, den SchülerInnen im Umgang mit dem schulischen Alltag einschlagen, ist eine Entwicklung zu Selbstständigkeit und Selbstverantwortung und entspricht damit einem allgemeinen Bild des Autonomieanspruchs Jugendlicher. Der Zeitpunkt des Verlangens nach eigenständiger Übernahme des Schulalltags variiert innerhalb der Schülerdaten wenig. Die meisten Jugendlichen setzen ihn mit dem Wechsel in die weiterführende Schule an. Als Beispiel hierfür steht das folgende Interview:
„Eltern sollten also einfach ab und zu nach den schulischen Dingen gucken und mal nach dem Notenstand fragen, aber sonst sollten sie es den Kindern in die Hand geben. Sie sollten es also nicht ganz ihren Kindern überlassen, sondern nur teilweise. In den Klassen vom 1. Schuljahr bis zum 4. sollten die Eltern aber jeden Tag nach der Schule fragen und ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Denn das ist der Start in das schulische Leben und dabei brauchen die kleinen Schulkinder Unterstützung“.
Bei Aufrechterhaltung einer grundsätzlichen Teilhabe am Schulleben werden hier deutliche Grenzen gezogen, ab wann von Jugendlichen eine ausreichende Selbstständigkeit empfunden wird, um im Schulleben auch ohne dominante Mithilfe und Kontrolle zu existieren.
7.5.3 „Im eigentlichen Sinn liegt es bei mir, ob ich für die Schule mehr oder weniger lerne“
Die handelnde Auseinandersetzung mit der selbstständigen Bewältigung von Inhalten der Lebenswelt Schule
Die autoritative und kontrollierende Position, die Eltern im ersten Lebensjahrzehnt ihrer Kinder durchaus noch einnehmen, weicht im zweiten Lebensjahrzehnt einer kontinuierlich sich vergrößernden Selbstverantwortung von jugendlichen SchülerInnen. Dabei wird für Jugendliche die generelle Selbstkontrolle bewusst, mehr oder weniger für die Schule zu tun und damit die Fähigkeit zu entwickeln, in „Verführungssituationen“ (Fend 1997, 341) durchzuhalten, um die überwiegend selbst kontrollierbaren Ziele zu erreichen.
In der Lebensphase Jugend kann aber auch eine Verfestigung der grundsätzlichen Haltung gegenüber schulischen Anforderungen festgestellt werden – „Ich denke, Schule ist sehr wichtig für das spätere Leben“ – , wodurch die Verortung von Schule für das Selbst einer Person und die soziale Bedeutung von schulischen Leistungen einen neuen Stellenwert erhalten. Jugendliche SchülerInnen entwickeln dadurch Ambitionen, durch die sie unabhängig von elterlicher Beteiligung sein und demzufolge auch – „das Gefühl der Selbstständigkeit“ – erleben wollen. Die Bestrebung zur Entwicklung des Selbst muss als ein Teil im Komplex des Umgangs mit Schule im Alter der Lebensphase Jugend angesehen werden, wobei ebenso die weiteren Bestandteile der sich wandelnden Verflechtungen von Leistungsorientierung und der Entwicklung von sozialen Beziehungsformen eine wesentliche Rolle einnehmen. Alle drei Teile führen dann schließlich dazu, dass Jugendliche den Lebensalltag Schule getrennt vom familiären Lebensalltag leben können.
Die Bedeutung des Hinweises „im eigentlichen Sinn“ verweist bei einer einseitigen Lesart auf die Gefahr, welche der eigenverantwortliche Umgang mit den schulischen Gegebenheiten, die in diesem Fall auf Leistungen reduziert wird, bietet. Die Darstellung einer Schülerin verweist auf diese Zwiespältigkeit zwischen Verantwortungsübernahme im Sinne von autonomem Handeln und dem Gefühl, diesen Herausforderungen nicht gewachsen zu sein: „Ich glaube, wenn meine Eltern mir nie sagen würden, dass ich was für die Schule tun soll, wären meine Noten ziemlich schnell schlechter, doch irgendwann würde ich selbst daran denken (was ich heute aber auch schon tue), meine Noten zu verbessern“. Diese Aussage unterstützt eine zweite Lesart und gibt dem Hinweis „eigentlich“ eine weitere Bedeutung: Im Falle des Bedarfes und der Notwendigkeit stehen Eltern unterstützend und helfend an der Seite ihrer Kinder, was von diesen auch gewünscht ist. Damit scheint hinsichtlich des unsicheren Umgangs mit Verantwortung eine Übereinstimmung mit den Elternaussagen vorzuliegen: Sowohl Eltern als auch Jugendliche weisen auf eine Situation hin, die einerseits geprägt ist von der wesentlichen Bedeutung schulischer Angelegenheiten und somit eines umfassenden Verantwortungshandelns bedarf, andererseits auf die noch nicht vollständig gefestigte Selbstständigkeit Heranwachsender, die eine Verantwortungsübernahme der Eltern erfordert. So sind Eltern bei wesentlichen Lebensinhalten ihrer Kinder mit der Frage konfrontiert, wie viel Selbstverantwortung sie ihren Kindern zumuten können (wie die Elternaussage – „es sind ja noch Kinder“ – bestätigt), und Jugendliche erkennen ihre Grenzen der Übernahme von Verantwortung, die sich in schulischer Hinsicht gerade in der Form einer disziplinierten Aufgabenbewältigung darstellt.
Andererseits wird von SchülerInnen eine Grenze hinsichtlich der elterlichen Verantwortungsübernahme dann gezogen, wenn sie sich einem elterlichen Anspruch ausgesetzt fühlen, dem sie nicht gewachsen sind. Diese Problematik wurde in der Analyse der Elterninterviews bereits unter der Darlegung des Phänomens „Leistungsdruck“ verdeutlicht, der den externen Bedingungen der Leistungsgesellschaft entstammt und über das Schulsystem in die Familie gerät –
„Ich finde es gut, wenn Eltern sich um die Schule kümmern. Nur die Eltern dürfen einen nicht unter Druck setzen, denn dann macht man irgendwann gar nichts mehr für die Schule. Die meisten Eltern fragen so viel nach, weil sie sich sorgen um ihre Kinder machen[…] Bei mir war das auch so, dass meine Mutter mich unter Druck gesetzt hat und immer wieder nachgefragt hat. Ich hatte deswegen keine Lust mehr zu lernen und ich wurde immer schlechter in der Schule. Das hatte dann die Folge, dass meine Mutter sich noch mehr Sorgen gemacht hat und immer mehr und öfter gefragt hat. Das ging mir alles total auf die Nerven!“
Der „Druck“, den die Schülerin beschreibt, beruht also auf einem Hintergrund, der bereits in der Darstellung der analysierten Elterninterviews deutlich wurde, und der sich als Produkt der Faktoren von gesellschaftlicher Leistungszentrierung, schulischen Leistungsvorgaben und schließlich der daraus resultierenden elterlichen Erwartungshaltung darstellt. Aus der Belegstelle wird der zuvor beschriebene Prozess der Loslösung von elterlicher Verantwortung für schulische Angelegenheiten nachvollziehbar. Das Markante an der Textstelle ist das dualistisch orientierte Modell des Bedarfs und der gleichzeitigen Begrenzung der elterlichen Teilnahme am Schulgeschehen.
7.5.4 „Jeder Mensch sollte zum Teil sich selbst überlassen sein […] aber Eltern müssen für ihre Kinder da sein, wenn sie sie brauchen“
Die Perspektive der zunehmenden autonomen Lebensbewältigung
Lebensverhältnisse, auf die hin Jugendliche erzogen werden, implizieren die Einübung individueller Verantwortung für ihre eigene Schul- und Lebensgeschichte. Dadurch werden auch das Lernverhalten im System Schule sowie der Umgang mit der Einbindung in weitere Sozialsysteme angesprochen, deren Anzahl im Laufe der menschlichen Entwicklung zunimmt. Hier eine für die Entwicklung Jugendlicher konstruktive Balance zu finden, scheint für Eltern wie auch für Jugendliche selbst eine schwierige Gratwanderung darzustellen.
Der Anspruch dieser Schülerin, dass Eltern „für ihre Kinder da sein[sollen; S.R.], wenn sie sie brauchen“ entspricht dem Bild der innerhalb des Elterninterviews analysierten, „bedarfsorientierten“ Umgangs mit Verantwortung und der Fürsorge, die Eltern ihren Kindern entgegenbringen wollen. Bezogen auf die Ausrichtung des schulischen Lebensalltags gestaltet sich dieses Abwägen auf Eltern- wie auf SchülerInnenseite vor dem Hintergrund der Folgen des „richtigen Handelns“ besonders schwierig. So wie Eltern in einen Konflikt geraten, der durch die Differenzen von familiären und schulischen Anforderungen und Ansprüchen an den jungen Menschen hervorgeht, so stehen Jugendliche selbst vor der Herausforderung, beiden Ansprüchen gerecht zu werden. Sie erwarten aber dann elterliche Unterstützung, wenn der Schulalltag sie an die Grenzen ihrer eigenverantwortlichen Belastbarkeit bringt. Stellt sich die Abwendung der Lebenswelt Familie hingegen als so evident dar, dass SchülerInnen eine Entfremdung erleben, so nehmen sie dies als Gefahr des Verlustes der familiären Lebenswelt wahr –
„Es ist mit Sicherheit gut, dem Schüler eine gewisse Verantwortung für seine Schule (33) zu übertragen, da viele Elternteile berufstätig sind und daher auch wenig Zeit haben für Hausaufgaben oder das Lernen für Arbeiten. Diese Kinder werden meist auch sehr schnell selbstständig. Aber wenn ich den Satz höre ‚Es ist mir egal, was du in der Schule und für die Schule machst’, hat das relativ wenig mit Verantwortung zu tun. Wie muss sich das Kind in dieser Situation mit diesen Eltern fühlen? Es weiß ganz genau, dass es für seine gesamte Schule die Verantwortung hat. Ich finde, dass es zu viel verlangt ist, einem Schüler, egal welchen Alters, so eine Verantwortung zu übertragen[…]Wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern mir so einen Satz an den Kopf werfen würden, würde für mich eine Welt zusammenbrechen“.
Der „Zusammenbruch“ der Lebenswelt Familie steht für das Vorherrschen des trotz nach Selbstständigkeit strebenden „humanen Systems“ von Jugendlichen, die in der Phase der Selbstfindung und Selbstentwicklung weiterhin nach Bezugspersonen verlangen, die sie nur in der familiären Lebenswelt finden und die der schulische Alltag nur in Ausnahmefällen bieten kann (etwa bei innerfamiliären Problemen). Die Übernahme der Verantwortung für die Bewältigung des Schulalltages seitens der Eltern stellt sich zwar als durchaus erwünscht dar, darf aber nicht in eine Form von „Desinteresse“ umschlagen.
Die Vereinbarung beider Lebenswelten kann zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung also nur dann erreicht werden, wenn hinter dem institutionellen Schulsystem die Familie als humanitäres System steht – „Die meisten Kinder wollen vielleicht auch die ganze Verantwortung auf sich nehmen, aber die Aufgabe der Eltern ist es, trotzdem hinter ihnen zu stehen“.
7.5.5 „Vor Lehrern hat man mehr Hemmungen zuzugeben, wenn man was nicht kann“
Die Differenzierung zwischen Leistungsprinzip in der Schule und Humanitätsprinzip in der Familie
Im ersten Kapitel wurde der zentrale Unterschied, der Familie und Schule im Kontext der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen trennt, bereits ausführlich erörtert. Dazu gehört u. a. die enge und lebenslängliche Eingebundenheit von Individuen auf emotionaler und vertrauensvoller Basis in die Familie und, im Gegenzug dazu, die universalistische und funktional ausgerichtete Organisation der Schule, die das Individuum während der Schulzeit nach seinen Leistungen bewertet und es in die Position als „Einer von vielen“ bestimmt. Dies entspricht auch der Wahrnehmung von Jugendlichen im Schulsystem, die durch offensichtliche und unterschwellige Signale im Schulalltag entsprechende Handlungsweisen zu differenzieren wissen.
Die bewusste Lebensweltdifferenzierung, die Jugendliche als Kinder ihrer Eltern und SchülerInnen des Bildungssystems vornehmen, verlangt von ihnen eine Identitätsfindung, die beiden Systemen entspricht und wo sie als TeilnehmerInnen ihr Handeln „systemgerecht“ zu bestimmen lernen –
„Ich finde es besser, wenn die eigenen Eltern einem helfen können[…] Bei den Eltern ist das noch mal was ganz anderes. Da kommt man sich nicht so doof vor oder schämt sich“. „Wenn die Eltern was erklären, versteht man es meist besser, als wenn man es von einem Lehrer erklärt bekommt, weil da kann man halt auch mehrmals nachfragen, wenn man es immer noch nicht verstanden hat“.
Die Aussagen der Jugendlichen bestätigen ihre Fähigkeit des Erkennens und Differenzierens von Handlungsformen in den beiden wesentlichen Lebenswelten Familie und Schule: Als SchülerInnen wollen sie den schulspezifischen autonomen Handlungsspielraum möglichst weiträumig gestalten, geht es aber um eine humanitäre Offenlegung von Unzulänglichkeiten gegenüber schulischen Anforderungen, durch den das Individuum im System Schule als „versagend“ positioniert würde, suchen sie das humanitäre Familiensystemmilieu auf.
Die Problematik, dem Leistungsanspruch gerecht zu werden und gleichzeitig die Unterstützung durch das in der Familie verankerte Humanitätsprinzip zu finden, zeichnet sich im Elternhaus ab, indem Jugendliche verantwortliches Lernen nicht nur mit der Einsicht des eigenen Nutzens, sondern auch hinsichtlich der Anspruchshaltung ihrer Eltern praktizieren – Ich finde es gut, dass meine Eltern sich so um meine Schulaufgaben kümmern, da ich sonst wahrscheinlich die Schule vernachlässigen würde“ und somit auch das Elternhaus als leistungsorientierte und –kontrollierende Institution einordnen, die sich durch die Anforderungen der Schule in einer leistungsorientierten Gesellschaft zu solidarisieren scheint. Das zentrale Thema, welches hierbei angesprochen wird, soll im weiteren Analyseverlauf als Kategorie mit der Bezeichnung Erwartung von Unterstützung durch die Eltern bezeichnet werden.
Der Umgang mit dem Schulalltag zu Hause zeigt sich allerdings für jugendliche SchülerInnen als ein Balanceakt, der es erfordert, die selbstständige und verantwortungsbewusste Übernahme schulischer Angelegenheiten mit den Ansprüchen von Elternhaus und Schule zu vereinbaren. Dabei wird der Anspruch der Jugendlichen deutlich, Schule als ihre eigene Lebenswelt zu betrachten, in denen Eltern allenfalls die Aufgabe einer unterstützenden Funktion zukommt. In diesem Generierungsschritt der Hypothese vom Umgang der SchülerInnen mit der Lebenswelt Schule in der Lebenswelt Familie entsteht die Frage: Auf welchem Grad bewegt sich die Differenzierung von Verantwortungsübernahme der SchülerInnen selbst und Verantwortungsübertragung an die Eltern? Mit anderen Worten: Wie viel elterliche Verantwortungsübernahme lassen jugendliche SchülerInnen hinsichtlich der Bewältigung ihres Schulalltags zu? Als Antwort auf diese Frage wird folgende Hypothese aufgestellt:
Je unkomplizierter sich der Schulalltag gestaltet und je eher die Leistungserwartungen der Schule durch die jugendlichen SchülerInnen selbst erfüllt werden können, desto weniger verlangen sie nach Teilhabe ihrer Eltern am Schulleben. Der Wunsch nach dem Interesse der Eltern für den schulischen Bewältigungsablauf bleibt jedoch bestehen.
Ein weiteres zentrales Phänomen, welches durch die oben genannten Aussagen hervortritt, belegt die prinzipielle Übernahme der Verantwortung von SchülerInnen für ihren eigenen Schulalltag und damit die Entwicklung einer sozialen und funktionalen Kompetenz. Im Hinblick auf diese Gegebenheit kann das Phänomen „Umgang mit Verantwortung“ wie bei den Eltern als charakterisierend bezeichnet werden, wenn es um die Frage der Verarbeitung des Schulalltags im Familiealltag geht. Die Darstellung der übernehmenden Verantwortungsposition kann dabei für alle befragten jugendlichen SchülerInnen als relevant angesehen werden, da eine abweichende Einstellung trotz der unterschiedlichen Bedingungen der familiären Voraussetzungen (als Kind von alleine Erziehenden, Einzelkind, hinsichtlich des Bildungs- und Berufsstatus der Eltern usw.) nicht vorzufinden war. Dabei lässt sich nicht immer eindeutig bestimmen, ob der jeweilige Umgang mit Verantwortung als Folge oder ursächliches Ereignis bezeichnet werden kann. So ist es zum Beispiel möglich, dass Jugendliche gerade deswegen betonen, die Verantwortung für ihr Schulleben selbst übernehmen zu wollen, weil ihre Eltern dies von ihnen erwarten – „Meine Eltern sagen, wenn ich eine schlechte Note bekomme, ist es ganz einfach meine Schuld“ – es sich also um die von Eltern zugewiesene Verantwortung für Schulleistungen handelt, oder im entgegengesetzten Sinne Eltern die Verantwortungsübernahme deswegen aufgeben, weil ihre Kinder sie vom Schulleben ausschließen – „Die Schule ist die Sache des Schülers“. Da aber in keinem Fall eine eindeutige und strikte Form des Umgangs mit Verantwortung festgestellt werden kann, sondern, darauf wurde bereits im Rahmen der Darstellung des Phänomens Verantwortung der Elternaussagen verwiesen (7.2.2), jeweils „Mischformen“ vorhanden sind, kann davon ausgegangen werden, dass das gewünschte und praktizierte Verantwortungshandeln dem tatsächlichen individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten entspricht.
Zum Bereich der Verantwortung, die Jugendliche für den Schulalltag selbst übernehmen wollen, zählen zunächst die an SchülerInnen herangetragenen spezifischen Aufgaben der Schule (Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitung etc.), aber auch solche Herausforderungen, die den Gegebenheiten der schulischen Lebenswelt entspringen und die Erfüllung von umfangreichen Verhaltenserwartungen, die weitaus konsequenter eingefordert werden als in der Familie: Werden Verhaltenserwartungen von LehrerInnen nicht erfüllt, so bedienen sich die Autoritätspersonen im Schulsystem nicht nur ihrer Erwachsenenrolle, sondern auch den dahinter stehenden institutionellen „Zwangsmittel“, wie z. B. Strafarbeiten, Klassenbucheinträge usw. Solche Maßnahmen können von SchülerInnen umgangen werden, wenn sie den Anforderungen von Schule und LehrerInnen optimal nachkommen. Dies gelingt offensichtlich im Verlauf des Schullebens immer besser, so dass SchülerInnen sich schließlich auch mit den Erwartungen identifizieren können, die der Schulalltag mit sich bringt. In der Lebensphase Jugend gelingt es schließlich, die Schule und den damit verbundenen Schulalltag als eine weitere wesentliche Lebenswelt anzusehen, so dass die Familie in ihrer primären Funktion zwar nicht unterlaufen wird, jedoch hinsichtlich des Schullebens mehr die Rolle einer unterstützenden Instanz im Hintergrund erhält.
Das führt zu einer weiteren These, die sich hinsichtlich der Betrachtung der Elternperspektive zum Schulalltag nicht phänomenal, aber hinsichtlich der Eigenschaften des Phänomens unterscheidet:
Auch SchülerInnen lassen ein Modell der „anderen Welt“ entstehen, geben dieser anderen Lebenswelt aber im Gegensatz zu der Elternperspektive den Charakter einer Bereicherung für ihr selbstständiges Handeln in einer Welt, zu der Eltern einen nur indirekten Zugang haben.
Der Schulalltag wird somit neben der Familie zu einer weiteren Lebenswelt, wobei dieser von SchülerInnen als Konstruktion einer akzeptierten lebensweltlichen Einbettung in den familiären wie den schulischen Alltag angenommen wird. Dabei verändert sich die Familieninteraktion in der Art, dass Eltern nicht mehr in jedes außerfamiliäre Geschehen einbezogen werden – „Also meiner Meinung nach sollten sich Eltern nicht ganz so viel für ihr Kind und dessen Schule engagieren, aber sie sollen es auch nicht ganz allein lassen. Ich meine, so ab und zu können sie schon mal fragen, wie es in der Schule war, aber eigentlich möchte man ja auch zu Hause nicht alles von der Schule erzählen“ – und Schule somit die Möglichkeit bietet – „mal auf eigenen Füßen zu stehen“.
Anhand des folgenden Paradigmas werden nun die wesentlichen Aussagen aufgeführt, die repräsentativ für die zentrale Kategorie der eigenen Lebenswelt Schule stehen. Phänomen: Die Schule als eigene Welt von jugendlichen SchülerInnen
Dieses Ergebnis, das zunächst aus dem empirischen Datenmaterial analysiert wurde, soll nun in einer theoretischen Übersicht durch das Heranziehen von einschlägiger Literatur dargestellt und präzisiert werden.
Eine Verbindung der entwicklungspsychologischen und soziologischen einschlägigen Literatur und den bisher generierten Thesen zum Verhältnis jugendlicher SchülerInnen zur Schulwelt geschieht im methodischen Sinne der Grounded Theory durch den Wechsel vom induktiven zum deduktiven Denken. Der Einsatz von Literatur (34) als sekundärer Datenquelle dient dabei zum Unterstützen, Widerlegen oder Modifizieren eigener Annahmen und dadurch schließlich der Untermauerung der Theoriegenerierung. Im Falle der Analyse von SchülerInnendaten bietet sich dieses methodische Instrumentarium an, da hierzu –im Gegensatz zum Thema „Eltern im Umgang mit dem Schulalltag“ –eine Vielzahl von wissenschaftlichen Beiträgen älteren wie aktuellen Datums vorliegt(35).
Mit der Hauptkategorie „Umgang mit Verantwortung“, die aus dem empirischen Material generiert werden konnte und auf Seite der SchülerInnen im Kontext der Phase des Erwachsenwerdens eine zentrale Bedeutung erhält, lässt sich die bisherige Hypothese durch entwicklungspsychologische Thesen verfestigen.
Abb. VII.10: Kodierte Zentralthemen und entwicklungspsychologische Thesen
7.6 Zur logischen Verknüpfung der generierten Phänomene
Durch die globale Datenkonzeptualisierung, die aus den Aufsätzen der SchülerInnen hergestellt werden konnte, kann mit dem theoretisierenden Hintergrund von entwicklungspsychologischen Thesen nun eine integrierende Theorieskizze der Konstruktion der außerfamiliären Lebenswelt Schule generiert werden. Wie bereits bei den Elterninterviews erfolgt dies im Rahmen einer objektiven Analyse, durch welche die Forscherin die bisher bewusst betonte Perspektive der SchülerInnen verlässt mit dem Ziel, die innere logische Konsistenz des bisherigen Theoriebaus zu unterstützen. Um einen Integrationsrahmen der Daten in einer inneren Logik der zentralen Bausteine und deren Inhalte zu präzisieren, wird aus den zentralen Phänomenen um die Lebenswelt Schule eine Begründungsbasis für die Konstruktion der „eigenen Welt“ gestaltet.
Der Umgang mit Verantwortung für schulische Angelegenheiten verlagert sich im Verlauf der Schulzeit immer mehr auf SchülerInnen. Die Gründe hierfür liegen zum einen im kognitiven und sozialen Entwicklungsverlauf Heranwachsender, zum anderen zeigt sich, dass schulische Inhalte und Anforderungen nicht von allen Eltern bewältigt werden können, da hierzu entweder das Wissen fehlt oder eine umfangreiche Einbindung in andere Verpflichtungen wie die Betreuung weiterer Kinder in der Familie, Berufstätigkeit usw. besteht. Somit ist die Strategie der übernehmenden Verantwortung seitens der jugendlichen SchülerInnen sowohl für die Jugendphase innerhalb des menschlichen Entwicklungsverlaufs bezeichnend als auch für familiäre Begleitumstände, welche eine Aufteilung von Verantwortung prädestinieren, wobei die Übernahme der Verantwortung durch die SchülerInnen auch ein Resultat der Übertragung seitens der Eltern darstellen kann. Insgesamt stellt sich der konkrete Schulalltag für den jungen Menschen als Ort des „Ausprobierens“ sozialer und fachlicher Kompetenzen dar und initiiert somit auch einen Rückkopplungseffekt auf die Bedeutung der elterlichen Unterstützung: Je mehr Verantwortung durch SchülerInnen selbst übernommen werden kann, desto eher können Eltern den Rückzug aus schulischem Verantwortungshandeln vollziehen.
Das bedeutet aber nicht, dass familientypisches Handeln dabei unterlaufen oder abgelehnt wird.
Am Gegenpol des Autonomieanspruches Jugendlicher bestehen weiterhin individuelle Bedürfnisse nach familiären Leistungen, die weder von der Schule übernommen werden können, noch kann der junge Mensch auf diese verzichten: Es handelt sich um die elterliche Unterstützung im Sinne eines Humanitätsprinzips, die im erzieherischen und sozialisationstheoretischen Kontext Jugendlicher einer umfassenden Realität der Lebenswelten Jugendlicher weiterhin vorhanden ist und gefordert wird. Durch diese zweidimensionale Ausrichtung von Abgabe und Übernahme verantwortlichen und fürsorglichen Handelns wird einmal die Selbstständigkeit Jugendlicher gefördert, andererseits besteht aber die Gewissheit eines Schutzraumes im sozialen Geflecht der Familie, das damit vor allem auch einen emotionalen Zuständigkeitsbereich bildet.
Die Konstruktion einer wichtigen und bedeutsamen Umwelt, in der Jugendliche als SchülerInnen einen nicht unerheblichen Anteil in dieser Lebensphase verbringen, stellt sich also nicht nur als Konstrukt wissenschaftlicher Theorien dar, sondern wird von der Familie, aber auch von den Jugendlichen selbst erlebt. Die Schule als eigene Lebenswelt erhält somit neben Familie und Peers den bedeutsamsten Charakter im Leben Jugendlicher und dient damit der Findung einer individuellen Position im gesellschaftlichen Sein, die Verortung der Selbstposition im Komplex sozialer Verflechtungen. Da diese Bedeutung sowohl für Jugendliche als auch für Eltern im Prozess einer Bewältigungsphase der Lebensphase Jugend als Übergang angesehen werden muss, ergibt sich auf der konkreten Handlungsebene ein noch nicht selbstverständlicher und gefestigter Umgang mit Verantwortung innerhalb der sich gegenseitig beeinflussenden Lebenswelten.
7.7 Schule als „Eigene Lebenswelt“ von Jugendlichen – Schule als „Andere Welt“ für Eltern: Eine Vergleichsanalyse
Die zentralen Themen, die aus dem empirischen Material der SchülerInnenaufsätze generiert und sozusagen im Sinne einer komparativen Analyse den zentralen Kategorien der Elterninterviews unterzogen und zugeordnet werden konnten, weisen schließlich auf Seiten der SchülerInnen auf die ermittelten Hauptphänomene hinsichtlich der Schule als Lebenswelt neben der Familie hin. Der Unterschied im Bereich der Eigenschaften zeigt sich bei SchülerInnen im Vergleich zur elterlichen Auslegung darin, das Schule als „eigene“ Lebenswelt beschrieben wird, die Jugendliche für sich beanspruchen und ihre Eltern aus diesem Stück autonomen Lebens ab- bzw. ausgrenzen. Die weiter oben beschriebene Distanzierung der Eltern aus der schulischen Lebenswelt hängt insofern – neben den weiteren kontextualen Bedingungen – auch mit dem offensichtlichen Autonomiestreben der jugendlichen SchülerInnen zusammen, so dass eine Verbindung zwischen den Eigenschaften Abgrenzung und Distanzierung andererseits besteht. Für diesen Sachverhalt kann die folgende Hypothese aufgestellt werden:
Wenn jugendliche SchülerInnen bereit und dazu fähig sind, ihr schulisches Handeln selbst zu übernehmen, erwarten sie den Rückzug ihrer Eltern aus dem Schulalltag.
Gleichzeitig gelingt es ihnen anscheinend jedoch, eine Differenzierung der Inanspruchnahme familiärer und schulischer Leistungen vorzunehmen, so dass sie die Eltern im nur „Bedarfsfall“ bzw. zur emotionalen Unterstützung, z. B. bei Problemen mit LehrerInnen als Partner im Schulalltag konsultieren; schulspezifische Angelegenheiten werden, so weit dies möglich ist, vom Familienalltag getrennt. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum strategischen Vorgehen der Eltern im Umgang mit der Lebenswelt Schule: Sie erwarten von der Schule ähnliche Bedingungen, wie sie im Familienalltag vorzufinden sind, u. a. eine individuelle Perspektive, Verständnis auf der Ebene des Humanitätsprinzips usw. Finden sie solche Bedingungen nicht vor, so distanzieren sie sich in ablehnender Haltung vom „direkten“ Schulalltag. Die schulische Betreuung der Kinder findet dann allenfalls zu Hause statt.
Zusammenfassend kann die Situation von Eltern und SchülerInnen hinsichtlich der Bewältigung des Schulalltages durchaus unter dem Kriterium einer Differenzierung von Lebenswelten und der Ankopplung an verschiedene Funktionssysteme verglichen werden. Während jedoch Eltern bis zum erwartbaren Ende der Schulzeit ihrer Kinder eine zunehmende Distanzierung von schulischen Angelegenheiten durch kontextuale Bedingungen wie Belastung durch den schulischen Alltag, Ängste und Sorgen wegen des bevorstehenden Schulabschlusses usw. aufweisen, gelingt es Jugendlichen, die zwar auch durch schulische Erwartungshaltungen und Leistungsdruck belastet werden, den Schulalltag für ihre Entwicklung eigener Verantwortungsübernahme zu nutzen und damit einen hohen Grad an Selbstständigkeit in einem Bereich zu erlangen, der für ihre Eltern nur indirekten Zugang bietet.
Jugendlichen SchülerInnen distanzieren sich im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung und der Konstitution des Selbst-Systems mit zunehmender Reife mehr und mehr von elterlichem Einfluss, da andere Sozialsysteme (z. B. Gleichaltrige) als ausschlaggebend für ihr Handeln angesehen werden. Schule wird somit zu einem Bereich, den Eltern schließlich nur noch am Rande begleiten.
7.8 Der „rote Faden“ der Geschichte von jugendlichen SchülerInnen
Jugendliche SchülerInnen befinden sich in einer Phase der menschlichen Entwicklung, in der sie nach einer Balance zwischen Autonomie und familiärer Unterstützung auf funktionaler und Geborgenheit auf emotionaler Basis bei der Bewältigung des Schulalltags suchen. Der Schulalltag, der als wesentliche weitere Lebensumwelt nun die Umwelt Familie hinsichtlich des Strebens nach Autonomie vermehrt in den Hintergrund rückt, ermöglicht die Identifizierung mit den Anforderungen und Inhalten des schulischen Alltags. Jugendliche wünschen sehr wohl die Autonomie und Verantwortungsübernahme im Rahmen „ihrer“ Schule, fordern aber gleichermaßen die notwendige Hilfe und Aufmerksamkeit ihrer Eltern, wenn sie alleine nicht zurechtkommen. Dieses Bild entspricht dem des verhandlungsorientierten Haushaltes der modernen Familie, der bereits mehrfach angesprochen wurde. Die Forderung nach einem autonomen Umgang mit dem eigenen Schulalltag verweist auf zwei wesentliche Entwicklungslinien der Lebensphase Jugend: Erstens handelt es sich dabei um die Verlängerung dieser Lebensphase, wodurch der Eltern-Kind- und LehrerInnen-SchülerInnen-Kontakt über einen verhältnismäßig langen Zeitraum bestehen bleibt und damit auch hinsichtlich der Altersstufen von Jugendlichen eine Ausweitung erfährt, und zweitens hat die Ausdehnung des Bildungssystems dazu geführt, dass die Schule eine wesentliche lebensweltliche Grundlage für Kinder und Jugendliche darstellt.
Obwohl sich die familiäre Ausgangssituation der einzelnen Jugendlichen sehr unterschiedlich darstellt, kann für den Umgang mit dem Schulleben innerhalb der untersuchten SchülerInnengruppe ein überwiegender Trend zum Wunsch nach größtmöglicher Autonomie im schulischen Handeln festgestellt werden. So zeigen Bedingungen von Haushalten allein erziehender Elternteile, Einzelkindsituationen oder „großfamiliäre“ Verhältnisse ebenso wenig Veränderungen in diesem Wunsch, wie der Umfang oder die Art der Berufstätigkeit von Eltern oder Elternteilen. Voraussetzungen wie Berufstätigkeit, Familienstand und Kinderzahl weisen somit für Eltern auf einen wesentlich höheren Belastungsfaktor, der schließlich in den schulischen Bewältigungsprozesses einfließt, als dies für jugendliche SchülerInnen der Fall ist.
Der Umgang mit dem Schulalltag im Familienalltag stellt sich für Jugendliche als ein Kommunikationsgeschehen dar, in das sie Eltern nicht immer einbeziehen möchten. Sie erkennen die Notwendigkeit der Entwicklung zur Autonomie und sehen in der selbstständigen Bewältigung der schulischen Anforderungen die Möglichkeit, ihren Weg zum Erwachsenwerden in eigener Verantwortung zu leisten, so weit und so lange dies möglich ist. Dennoch verliert die Familie gerade in emotional-begleitender Hinsicht nicht an Bedeutung und wird in jedem analysierten Aufsatz der SchülerInnen als unterstützende und fürsorgende Lebenswelt gesehen, die man bei Bedarf in Anspruch nimmt und das autonome Handeln damit wieder mit der Familie teilt.
Im Gegensatz zu den befragten Eltern stellt sich die „Andere Welt“ der Schule eher als eine bereichernde Lebenswelt dar, die ihnen die Chance gibt, sich auf das Erwachsenenleben vorzubereiten und verantwortlich etwas „Eigenes“ auf dem Weg dieser Entwicklung behandeln zu können. Das schließt nicht aus, dass auch jugendliche SchülerInnen Belastungen, Sorgen und Ängste innerhalb der Bewältigung des Schulalltags erleben und äußern. Diese sind jedoch noch nicht so sehr auf die Perspektive des „Versagens“ in der Leistungsgesellschaft ausgerichtet, wie dies bei Eltern der Fall ist. Die Ursache hierfür kann wohl in der für SchülerInnen facettenreichen Darstellung des Schulalltags liegen, der mehr zu bieten hat als Noten und Zeugnisse: Hier finden sich täglich Gleichaltrige, die einen jugendkulturspezifischen Erfahrungsaustausch betreiben und gemeinsame Interessen teilen.
(36)
Fußnoten
(1) Zum Verfahren des offenen Kodierens vgl. Strauss/ Corbin 1996, 44 ff.
(2) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 50.
(3) Memos sind schriftliche Analyseprotokolle, die als erste Ergebnisse der Analyse angesehen werden können. Sie „stellen die schriftlichen Formen unseres abstrakten Denkens über die Daten dar…“ (Strauss/ Corbin 1996, 170).
(4) Es wird hier absichtlich von „Erziehung“ gesprochen, um noch einmal den Unterschied zu dem vielfach verwendeten Begriff der „Partizipation“ am Schulleben hervorzuheben. Partizipation wird in dieser Arbeit aber nur als Einbettung in das erzieherische Verhalten der Eltern (und dazu gehört eben auch die Betreuung während des Schulverlaufes) angesehen.
(5) Ausführlicher wird auf das Theoretical Sampling im sechsten Kapitel (6.4; 6.7.1) eingegangen.
(6) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 171 ff.
(7) Die hier zitierten Belegstellen sind im Verlauf durchaus mehrmals zu verwenden. Dadurch zeigt sich der zirkuläre Prozess im Umgang und der Analyse der Daten und es wird die Verwobenheit der Kategorien und Subkategorien auch für den Leser bzw. die Leserin deutlich, die nicht das ausführliche Datenmaterial kennen. Die Belegstellen werden hier ohne Transkriptionszeichen dargestellt, so dass ein flüssiges Lesen gewährleistet ist. Des Weiteren wird darauf verzichtet, die Daten der Erstellung des jeweiligen Memos zu kennzeichnen.]
(8) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 178 ff.
(9) Auf die Definition der einzelnen Begriffe soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Vgl. hierzu Strauss/Corbin 1996, 78 ff.
(10) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 75 ff.
(11) Ebd., 44.
(12) Strauss/ Corbin 1996, 86 ff.
(13) Vgl. Ackermann/ Wissinger 1998 und Kempfert 2000.
(14) Eine Eindeutigkeit in der Definition von Qualität im Sinne einer „guten Schule“ kann derzeit – trotz der inzwischen umfangreichen Literatur zu diesem Thema – nicht ausgemacht werden, und es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, Schulqualität zu bestimmen.
(15) Auch wenn eine ständische Einordnung heute eher als antiquiertes Kriterium für die Auswahl des Freundeskreises gilt, so möchte ich diesen Begriff hier verwenden, da die untersuchte Gruppe von Eltern und Kindern in einem sehr ländlichen Gebiet zu Hause sind, wo dies durchaus von bedeutender Natur ist.
(16) Der Begriff „erfolgreich“ wird an dieser Stelle so verwendet, dass er die vielfältig angeordneten Facetten umfasst, die Eltern zur Bewältigung des Schulalltags ihrer Kinder aufwenden. Die „erfolgreiche Bewältigung“ erlangt hier aber keinesfalls den Charakter einer leistungszentrierten Schullaufbahn.
(17) Vgl. ausführlich hierzu Kapitel III dieser Arbeit sowie Krüger u. a. 2000.
(18) Dies lässt sich auch innerhalb der Studie zur Leistungsorientierung der Eltern (Krüger u. a. 2000) feststellen, wobei sich Eltern von Heranwachsenden auf Grund der guten Schulleistungen aus der Regelung schulischer Belange vertrauensvoll zurückziehen. Bei der untersuchten Elterngruppe handelte es sich um solche, deren familiärer Erziehungsstil der eines modernisierten Befehlshaushalt ist (59 ff).
(19) Hierzu möchte ich einen Grundschulkollegen zitieren, der zu Beginn des Schuljahres von den Eltern der jungen GrundschülerInnen stets dieselbe und für Eltern anscheinend wesentliche Frage gestellt bekommt: „Sollen die Kinder zum Sportunterricht Schläppchen oder feste Turnschuhe mitbringen?“ Solche Fragen stellen sich in den weiterführenden Klassenstufen selbstverständlich nicht mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern hierzu nichts mehr zu sagen haben, da SchülerInnen bereits ab der sechsten Klassenstufe solche Dinge selbst entscheiden.
(20) Bereits im einleitenden Teil dieser Arbeit wurden Faktoren wie zum Beispiel der sozioökonomischen Status, das soziale Kapital usw. der Eltern angesprochen, die zwar grundsätzlich Lern- und Leistungsbereitschaft fördern können, nicht aber in jedem Fall einen Kausalzusammenhang hierzu darstellen.
(21) Diese Erwartungshaltung besteht auch umgekehrt seitens der Institution Schule, die von der Familie fordert, mehr für die Voraussetzung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen zu leisten, da LehrerInnen mit dem Erreichen dieser Grundvoraussetzung für einen regelbaren Unterrichtsablauf überfordert seien (vgl. Kramer/ Helsper 2000, 201)
(22) Z. B. Kramer/ Helsper 2000
(23) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 96.
(24) Vgl. Glaser 1978, 72 ff.
(25) Die „Entwicklung“ von Ängsten und Sorgen deutet darauf hin, dass es sich hierbei um ein Phänomen handelt, welches die gesamte Schulzeit begleitet, in seiner qualitativen und quantitativen Ausprägung jedoch variiert und gegen Ende der Schullaufbahn aus den erwähnten Gründen der Statuspassage einen Höhepunkt ansteuert.
(26) Vgl. z. B. Bietau u.a. 1981.
(27) Als Beispiel hierfür möchte ich ein Zitat aus einem Interview mit der Vorsitzenden des Bundeselternrates, Frau Renate Hendricks vorstellen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Elternvertreterin intensiv mit den Möglichkeiten der Beteiligung von Eltern am Schulleben beschäftigt hat: „Ich habe Eltern in wirklicher Not erlebt, in totaler Verzweiflung, weil sie sich nicht erwehren konnten[…]Das Schulsystem sieht Eltern als Partner gar nicht vor. Elternarbeit ist größtenteils eine Alibiveranstaltung, die Eltern ruhig stellen soll. Es gibt in unserer Schule eine Kultur des Miteinanders, der gegenseitigen Beratung, des Vertrauens[…]Die Schule ist ein System, in dem Eltern mit ihren Kindern gemeinsam ums Überleben kämpfen. Und die Lehrer sind die Mächtigeren“ (aus: Die Zeit Nr. 22).
(28) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 94 ff.
(29) In Wirklichkeit handelt es sich natürlich nicht nur um eine Geschichte, sondern um mehrere Einzelgeschichen, die eine Zusammenfassung erfahren haben (vgl. dazu Strauss/ Corbin 1996, 97).
(30) Es gab nur einen Fall, der sich hinsichtlich dieser Einstellung von allen anderen unterschied „So lange sie wenigstens Schule machen können, sind sie ja beschäftigt, da weiß man, die machen irgend was“ und er insbesondere die schwierige nachschulische Situation der Stellensuche anspricht.
(31) Die nachfolgend zitierten Beispiele werden hinsichtlich ihrer Grammatik und Interpunktion so dargestellt, wie SchülerInnen sie in den Aufsätzen niedergeschrieben haben. Es wurde zum Zweck einer übersichtlichen und verständlichen Lesart einzig eine Berichtigung von Rechtschreibfehlern vorgenommen.
(32) Vgl. Portmann 1988/ Rolff 1997, S. 131 ff.
(33) Auf die besondere Bezeichnung „seine Schule“ werde ich im Verlauf der Datenanalyse von SchülerInnen-Aufsätze noch einmal eingehen, zeigt sich doch hier eine von SchülerInnen vorgenommene Differenzierung von zwei unterschiedlichen Welten.
(34) Z. B. du Bois-Reymond 1998.
(35) Vgl. Strauss/ Corbin 1996, 31 ff.
(36) Vgl. zu den verschiedenen Konzepten ausführlich Oerter/ Dreher 1998, 310 ff.
Nutzungsbedingungen:
Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, bzw. nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt – es darf nicht für öffentliche und/oder kommerzielle Zwecke außerhalb der Lehre vervielfältigt, bzw. vertrieben oder aufgeführt werden. Kopien dieses Dokuments müssen immer mit allen Urheberrechtshinweisen und Quellenangaben versehen bleiben. Mit der Nutzung des Dokuments werden keine Eigentumsrechte übertragen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.