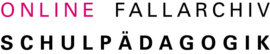Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Der nachfolgende Gesprächsausschnitt stammt aus einer ca. 45-minütigen Diskussion mit vier Jungen der Jahrgangsstufe drei. Er befindet sich etwa in der Mitte des Gesprächs. Vorangegangen ist ein Gespräch über eine vorgelesene Geschichte, in der ein fremdes Wesen auf die Erde kommt und sich von Kindern erklären lassen möchte, was Menschen sind. Die vorbereiteten Gesprächsimpulse (Karteikarten) liegen neben dem Interviewer auf dem Boden. Er sitzt mit den Jungen im Kreis.
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Es ist zu Anfang ein ziemliches Chaos im Raum. Vorne links beobachte ich, wie Olaf einem Mädchen (Valerie?) eine Ohrfeige verpasst, die bis zu mir in die hinterste Reihe schallt. (Das kann doch nicht sein, denke ich mir. Wie hat er diesen Effekt wieder hinbekommen? Das Geschehen ist zu weit weg, um es genauer zu beobachten.) In dem Mittelgang zwischen den Tischen, die in zwei Reihen hintereinander stehen, wagen Peter und Gerd ein Tänzchen. Peter hat seinen Arm um
Methode:
Fachdidaktik:
Downloads:
Der folgende Vorfall wurde von der Studentin I.S. beobachtet und beschrieben.
Schulform: Gymnasium; Klasse: 7
In einer Doppelstunde Sport wird ein Parcours für ein Zirkeltraining aufgebaut. An jeder Station soll zu zweit eine Aufgabe erledigt werden. Da die Klasse aus einer ungeraden Zahl an SchülerInnen besteht, gibt es an einer Station eine Dreiergruppe.
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Methode:
Fachdidaktik:
Downloads:
Der folgende Vorfall wurde von der Studentin M.F. beschrieben:
In einer großen Pause, in der sich die Schüler und Schülerinnen der Grundschule auf dem Schulhof befinden, führt die Lehrerin Frau A. Aufsicht. Sie beobachtet, wie sich einige Mädchen und Jungen ihrer 4. Klasse in stiller Absprache zum Fangspiel „Mädchen fangen“ auf einem bestimmten Platz auf dem Pausenhof zusammenfinden.
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Anlaß für meine kritischen Überlegungen ist ein Text aus dem Buch des Erziehungswissenschaftlers Arno Combe mit der Kapitelüberschrift: “Schulanfang 1990: Zur Erinnerung an Th. W. Adornos “Tabus über dem Lehrerberuf”. Die Normenfalle pädagogischen Handelns. Stellvertretende Deutung und Empathie als progressive Attidüde.” (Combe 1992, 169-176) (…)
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Frau Bertrams wohnt in einer Altbauwohnung in der Nähe des Stadtzentrums in guter Wohnlage. Die Wohnung ist individuell und künstlerisch eingerichtet. Die Interviewerin vermutet, daß Frau Bertrams dort allein lebt. Sie macht den Eindruck einer „höflichen, sanften, eher ruhigen und tiefsinnigen Frau, ca. Ende 40″, Sie macht Tee und bietet der Interviewerin dazu „Apfelkuchen mit Vollkornteig“ an. Nach kurzen Informationsfragen zum Forschungsprojekt und den Tätigkeiten der Interviewerin reagiert sie auf die Aussage, „nach dem Referendariat habe ich zunächst was
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Frau Cypri lebt nach einer langjährigen, gescheiterten Freundschaft allein mit Hund und Katze in einem abgelegenen Wochenendhaus am Waldrand. „Mir war es dort nicht geheuer“ (stud. Int.). Frau Cypri verdeutlicht im Interview ihre konfliktreiche Lebenssituation; ihre immer wieder betonte Liebe zu Tieren und Schutzbedürftigen war irgendwie merkwürdig und scheint mir vielleicht ein Ausdruck versagter Fürsorge zu sein, eine Verschiebung der eigenen Rufe nach Liebe und Geborgenheit auf „Menschen und Tiere, die sonst keiner will“ (stud. Int.).
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Frau Abel wohnt in einem kleinen Dorf, das nicht leicht zu erreichen ist. Sie weiß dies, rechnet mit einer Verspätung der Interviewerin und meint: „Manchmal ist es gut, daß einen die Leute nicht so leicht finden …!“
„Nach den einleitenden Worten beginnt sie sofort zu erzählen und ist kaum zu bremsen. Sie wirkt sehr dynamisch, selbstbewußt und vital, und ich muß ständig achtgeben, zwischen Kommenlassen, Strukturieren und Zeit(begrenzung) abzuwägen, was teilweise ganz schön anstrengend wird.
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
„Diese kleine Szene thematisiert zwei Knotenpunkte der Unterrichtskommunikation, bei denen der Unterschied zwischen schulischen Normen und sozialen Normen deutlich wird. Im ersten Fall verweigert Magnus sich doppelt: Er ist nicht bereit, die Gleichschaltung der Normen zu akzeptieren (konkret: selbst zu kochen); auch die Tatsache, dass sein Vater kocht (wenn die Mutter nicht zu Haus ist [(!!)], beeindruckt ihn wenig. Er distanziert sich von beiden (indirekten) Ansprüchen (Magnus: „NÖ“). Er würde es später nicht so machen. Selbst auf diese unverbindliche