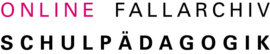Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
(Bericht einer Grundschullehrerin, anonym)
Ein Kind aus der zweiten Grundschulklasse drohte mich einmal aus meinem sonst recht gut eingefahrenen Geleise zu bringen. Kurti (…) war mir schon in der ersten Klasse aufgefallen, als er während verschiedener Unterrichtssituationen aus unerklärlichen Gründen zu weinen begonnen hatte. Damals dachte ich noch, daß sich dies schon legen werde, und reagierte nicht darauf. Im Verlauf des zweiten Schuljahres wurden die Weinausbrüche mir unbehaglich. Sie belasteten mich; ich begann mich dafür verantwortlich zu fühlen.
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Die in unserem Fallbeispiel von Friederike Heinzel (Heinzel 2001, S. 275ff) beobachtete und videografierte Klasse besteht aus 24 Kindern, 18 Mädchen und 6 Jungen. Die Klassenlehrerin ist Beatrix Becker, eine, reformpädagogischen Elementen, zugewandten Lehrerin. Der Unterricht beginnt jeden Morgen mit einem Kreisgespräch, täglich finden noch ein oder zwei weitere Kreisgespräche meist nach den Hofpausen statt und die Unterrichtswoche wird Freitags mit einem Schlusskreis beendet. Das Signal zum Beginn des Kreises gibt immer die Präsident/-in, welche dieses Amt durch schriftliche
Es geht in der folgenden Szene um eine Neuorganisation der Verteilung von Klassendiensten (wie „Tafeldienst“, „Blumengießen“ u.ä.) in einer Gruppe der 4. Jahrgangsstufe an der Laborschule Bielefeld. Die Neuregelung ist nötig geworden, weil die bestehende Regelung, bei der sich die „Schnellsten“ immer für den leichtesten Dienst melden und eintragen lassen, allgemein als ungerecht empfunden wird.
Die Existenz eines Curriculums für fünfjährige Kinder erklärt sich (…) damit, dass Fünfjährige in England bereits schulpflichtig sind. Mit dem im europäischen Vergleich sehr frühen Beginn der Schulpflicht ist jedoch keine Vorverlegung schulischen Lernens intendiert, sondern soll der allmähliche, von spielerischem Lernen geprägte Übergang von vorschulischen zu schulischen Lernen angebahnt werden. Dazu werden die Kinder nach ihrem vierten Geburtstag in die sogenannte ´Reception Class´ eingeschult, deren Konzeption von der Londoner Grundschule, in der ich meine Feldforschung durchführe, wie folgt
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Methode:
Fachdidaktik:
Downloads:
In […] Interviews wurden zunächst verschiedene mögliche Problemfelder des Schulalltags thematisiert (Lernprozesse und Lerninhalte, Leistungsanforderungen und -bewertungen, Sozialbeziehungen zu Lehrern und Mitschülern). […]
An die von den Schülern artikulierten Probleme schlossen sich Interviewerimpulse an, die auf die Problemlösungsversuche, also auf den Umgang mit dem berichteten Problem, abzielten (z. B. „Was macht Ihr denn dann?“ – „Wie reagiert Ihr darauf?“ – „Was habt Ihr dann unternommen?“).
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Methode:
Fachdidaktik:
Downloads:
Ursula Ullmann, Jahrgang 1946, ist eine der Schulleiterinnen, die mit ihrem Lebensentwurf nicht nur dem gegenwärtig vorherrschenden Modell weiblicher Lebensführung entspricht, sondern der es offensichtlich gelungen ist, Familie und Karriere miteinander zu verbinden: Seit dem Beginn des Referendariats im Jahre 1971 arbeitet sie kontinuierlich im Schuldienst und hat die sich ihr bietenden Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs genutzt. Dennoch lässt sie es in ihrer Selbstdarstellung so erscheinen, als sei ihr die Karriere, die für sie insgesamt zu klein geraten ist,
Autor/in:
Schulform:
Schlagworte:
Methode:
Fachdidaktik:
Downloads:
Lieselotte Tenbruck und ihr Zwillingsbruder kommen 1916 in einer hessischen Kleinstadt als die beiden jüngsten von insgesamt vier Kindern zur Welt. Der Vater, Buchdrucker von Beruf, führt eine kleine Buchdruckerei mit mehreren Angestellten, die schon seit Generationen in der Hand seiner Herkunftsfamilie liegt, während drei seiner Brüder eine akademische Laufbahn einschlagen. Vor dem Hintergrund der familialen beruflichen Tradition bildet er eine ausgeprägte Identifikation mit dem Buchdruckerstand aus. Zudem verfügt er über ein hohes soziales Ansehen im Ort, an dem
Autor/in:
Schulform:
In einer Schulklasse bildet sich zu Beginn des Schuljahres relativ rasch eine von „Übertragungen“ getönte „multistrukturierte Interaktion“ (Muck 1980, S. 159 ff.) aus, und es kommt zu einer schwer zu durchschauenden „Vermischung von Übertragungsbeziehungen mit den tabuierten und emotional geladenen institutionellen Realitäten“ (Drees 1984, S. 79). In der Haltung der Abstinenz bewährt sich dabei seitens des Lehrers eine selektiv-fokussierende und eine final-gestaltende Orientierung im Lernprozeß. Zudem werden wichtige Teilaspekte zum Konzept der „Übertragungsidentifizierung“ (Trescher 1993) und zur „Gegenübertragungsreaktion“ (Hirblinger
Falldarstellung Wenn wir von „Störung“ sprechen, so meinen wir immer eine Beziehungsstörung. An ihr sind zwei Personen beteiligt. Bei den Problemen der didaktischen Strukturierung geht es immer auch um die „dritte Sache“. Für Fehlentwicklungen in diesem Bereich möchte ich den Begriff „thematische Verzerrung“ (Flader 1977) verwenden. Shakespeare versinnlichte in seinem großartigen Drama „Der Kaufmann von Venedig“, lange bevor Kant seine berühmte „forensische Metapher“ entworfen hat, jenes Kräftespiel einer neuen Vernunft, mit dem eine mechanische Fixierung an gesetzmäßigen Orientierungen überwunden